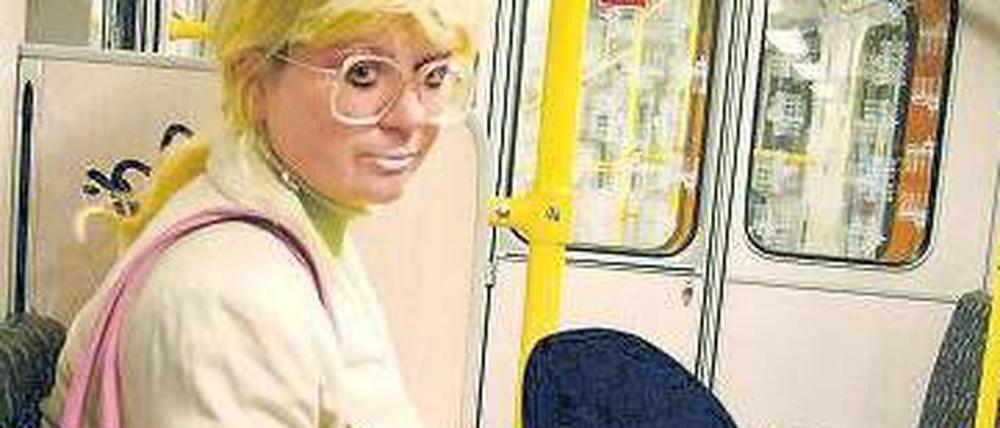
© Doti Moreno
Israelische Künstler in Berlin: Die neue Diaspora
Immer mehr junge israelische Künstler kommen nach Berlin. Hier können sie sagen, was zu Hause niemand hören will. Drei Porträts
Stand:
DIE SYSTEMKRITIKERIN
Auch die Folk-Sängerin Mary Ocher kehrte Israel vor drei Jahren den Rücken. Als russische Migrantin, die nach den jüdischen Religionsgesetzen nicht als Jüdin gilt, war auch sie in der israelischen Gesellschaft eine Außenseiterin. 2006 gründete sie mit Freunden die Band Mary and the Baby Cheeses. „Ein Jahr lang spielten wir überall, wo man uns auftreten ließ“, Ocher lacht, wenn sie daran zurückdenkt. Plattenfirmen interessierten sich nicht für sie. Zu avantgardistisch und kritisch war ihre Musik. „Irgendwann haben wir realisiert, dass wir in Israel nicht von unserer Musik leben können.“ Also zog Ocher mitsamt der vierköpfigen Band nach Berlin. Während die anderen nach und nach zurückgingen, ist Ocher geblieben. Sie tritt nun überwiegend als SoloKünstlerin auf.
„Der Umzug hat meine Probleme gelöst“, sagt die 23-jährige Singer-Songwriterin, die heute in einem Hausprojekt in Friedrichshain lebt, gemeinsam mit etwa zwanzig Mitbewohnern, „so genau weiß ich das nicht“. Es scheint, als habe sie nach der gefühlten Enge in Israel das Maximum an Offenheit in Berlin gewählt. „Politisch fühle ich mich total frei“, sagt Ocher. Und so macht sie auf ihrem neuen Konzeptalbum „War Songs“ sehr klar, was ihr an Israel nicht gefällt. Mal mit klagender, mal mit sich vor Energie überschlagender Stimme prangert sie die gesellschaftliche Meinungsmache an, kritisiert die regierende Elite: „They think they’re right / because they were born then / and they think that gives them / the right to be constantly wrong.“ Und den obligatorischen Militärdienst: „They tell me, you need to go / where to? / it doesn’t matter / saying this is the greatest / nation that ever was.“ Auch sie hätte ein solches Album in Israel wohl nur im Eigenverlag herausbringen können. Das Freund-Feind-Denken, das das Land prägt, führt auch im Privaten dazu, dass sich schnell nicht mehr willkommen fühlt, wer von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch macht.
Mary Ocher spielt am 11. Juni bei der FUL-Magazine-Party im Monster Ronson’s Ichiban Karaoke (Warschauer Str. 34, Friedrichshain) und am 15. Juni im Ä (Weserstr. 40, Neukölln).
DER WEHRDIENSTVERWEIGERER
Als Gabriel S. Moses 2004 zum ersten Mal nach Berlin kam, dachte er: „Wow! Das ist Mekka!“ Der 29-jährige Comiczeichner, Grafikdesigner und Autor aus Israel war verblüfft: „Du verlässt dein Land, in dem ständig Busse in die Luft gesprengt werden, in dem jeder jeden bekämpft – und hier ist es so friedlich, jeder kann einfach so sein, wie er ist.“ 2008 entschied er sich deshalb, auf der Suche nach einem Verleger für seine kritischen Graphic Novels, nach Berlin zu ziehen. Denn was in Israel als extrem oder unerhört gilt und einen Künstler schnell zum Außenseiter macht, ringt dem Publikum hier im besten Fall ein anerkennendes Nicken ab.
Vor allem junge, unangepasste Künstler, die in Israel oft kein Publikum für ihre Kunst finden, zieht es dauerhaft nach Berlin. Dort stoßen sie auf eine Toleranz, die sie in ihrem Heimatland vermissen. In Berlin ist mehr Raum für Ideen. „Wer Israel verlässt, flieht, weil er das Leben dort unerträglich findet“, sagt Moses über sich und seine israelischen Bekannten in Berlin. „Wir sind alle Eskapisten.“ Auch Geld spiele eine Rolle, sagt Moses: Selbst wer mit seiner Kunst nur wenig verdiene, könne in Berlin leichter überleben als etwa im teuren Tel Aviv.
Der Comiczeichner wuchs in Makabim auf, einer israelischen Neubausiedlung, die genau auf der Waffenstillstandslinie von 1967 liegt. Die Palästinensergebiete sind nur einen Steinwurf entfernt. „Wir haben den ganzen Tag über nichts anderes getan, als an einer Kreuzung auf einer Bank abzuhängen und Bier zu trinken“, schreibt Moses in seiner eben erschienenen autobiografischen Graphic Novel „Subz. Biographien aus einer israelischen Vorstadt“. „Während sie in der Stadt inmitten einer brennenden Straße Körperteile aus einem Buswrack aufsammelten, lehnten wir uns zurück und genossen unseren Acid-Trip.“
Nur mithilfe von Drogen und Musik ertragen „Gabs“ und die anderen Jugendlichen die Trostlosigkeit und Langeweile. Eine Coming-of-Age-Geschichte, wie sie überall auf der Welt spielen könnte, wäre da nicht der permanente Kriegszustand, in dem Israel sich mit seinen Nachbarn befindet. Die Vorstadtkids werden nach der Schule zum Militärdienst eingezogen und so Teil eines Konflikts, den sie zu verdrängen versuchen. Um diesen biografischen Einschnitt dreht sich Moses’ Comic, einer von Gabs’ Freunden kommt schließlich ums Leben.
In Wirklichkeit umging Gabriel S. Moses den Militärdienst, indem er sich gegenüber dem Militärpsychologen als selbstmordgefährdet ausgab. „Ich sagte, sie könnten einem problembelasteten, melancholischen, selbstfixierten und maßlosen Künstler wie mir keine Waffe in die Hand geben.“ Er wurde ausgemustert. In Israel gehört Moses mit der Entscheidung, nicht zur Armee zu gehen, zum linksextremen Rand der Gesellschaft. So pluralistisch Israel in anderer Hinsicht ist, sobald es um die Sicherheit des Volkes geht, wird der individuelle Spielraum eng. Für eine Geschichte über einen Jungen, den der Militärdienst so verstört, dass er an einer Überdosis stirbt, fand Moses keinen Verlag.
Die Graphic Novel „Subz. Biographien aus einer israelischen Vorstadt“ ist seit 8. Juni erhältlich (Archiv der Jugendkulturen, 120 S., 15 Euro).
DER NICHT-MEHR-ORTHODOXE
Auf anderer Ebene erlebte das der Fotograf Benyamin Reich. Der Sohn eines Rabbiners wuchs mit zehn Geschwistern in Bnei Brak auf, einer fast ausschließlich von strenggläubigen Juden bewohnten Stadt. „Ich lebte in einer Blase“, sagt Reich. Überschneidungen zwischen dem säkularen und dem religiösen Israel gab es für ihn nicht. Schon als Kind habe er sich in der Welt der Ultraorthodoxen eingesperrt gefühlt, sagt Reich. „Für freie Gedanken war kein Platz.“
Irgendwann nach seiner Barmizwa stellte er fest, dass er noch aus anderem Grund anders war: Es waren Männer, die ihn zu interessieren begannen. Homosexualität ist im ultraorthodoxen Judentum sowohl gesellschaftlich als auch theologisch ein Tabu. Reich begann darüber nachzudenken, die Gemeinschaft zu verlassen. Er wurde nachlässig in der Ausübung der religiösen Pflichten, bald trug er statt des traditionellen weißen Oberhemds bunte T-Shirts. Eines Tages schnitt er sich die Schläfenlocken ab. Ein revolutionärer Akt. „Für meine Familie wurde ich zur Schande, zum schwarzen Schaf.“ Er kam immer seltener nach Hause, aber auch dem weltlichen Leben Tel Avivs fühlte sich Reich nicht zugehörig. „Mein Äußeres hatte sich verändert, aber ich blieb im Geiste doch der orthodoxe Junge aus Bnei Brak“, wie der 33-Jährige heute sagt. „Ein Außenseiter in beiden Welten.“
Erst in der Kunst habe er zu sich selbst gefunden, sagt Reich, der 1998 zum Studium nach Paris ging und nun in Berlin lebt. „Durch meine Arbeit versuche ich, die beiden Welten, die mich ausmachen, zu vereinen.“ Seine Bilder thematisieren das religiöse Judentum, jedoch mit einem doppeldeutigen, bisweilen sogar erotisierenden Blick auf die Orthodoxen. Aus vielen seiner Fotografien spricht die Sehnsucht nach einer heilen Welt voller Geborgenheit und Zusammenhalt. Dieses ungestillte Verlangen nach Heimat ist es auch, was Reich nach Berlin kommen ließ. „Hier in der Fremde habe ich mir ein Israel erdacht, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt“, sagt er. Ein Idealbild, das sich nur in der Diaspora aufrechterhalten lässt. Er kehre zurück zur Tradition des wandernden Juden, der schon seine Großeltern entsprochen hätten, sagt Reich. „Berlin, eine Stadt mit bewegter Geschichte, ist dafür genau der richtige Ort.“
Reichs neueste Arbeiten sind von 25. Juni bis 6. August in der Galerie Glass (Pariser Str. 11, Wilmersdorf) zu sehen.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: