
© Paolo Pisacane / DOCDAYS
TV-Doku „Das Srebrenica Tape“: Botschaften eines Todgeweihten
Ein bosnischer Vater filme während des Krieges für seine Tochter den Alltag in Srebrenica. 30 Jahre später macht sie sich auf eine bewegende Spurensuche.
Stand:
Ein Mädchen mit hellblonden Haaren tanzt mit seinen Freundinnen durch die Wohnung, albert mit ihnen vor dem Fernseher herum, spielt im Garten. Homevideo-Aufnahmen vom Beginn der Neunziger, wie sie Eltern auf der ganzen Welt hunderttausendfach von ihren Kindern gemacht haben.
Diese stammt aus der ostbosnischen Stadt Srebrenica. Das blonde Mädchen heißt Alisa, sie ist die Tochter einer Serbin und eines Bosniaken. In Jugoslawien nichts Besonderes, doch als 1992 der Krieg in Bosnien und Herzegowina beginnt, teilt sich plötzlich alles anhand dieser Zugehörigkeiten auf.
Die Eltern bringen die neunjährige Alisa zu ihrer Großmutter ins serbische Ljubovija, das nur 16 Kilometer entfernt liegt. Sie selber bleiben in der Stadt, die ab 1993 von der UN zu einer Schutzzone erklärt wird und mit rund 40.000 Geflüchteten bald völlig überfüllt ist.
Den dortigen Alltag dokumentiert Alisas Vater Sejfudin, genannt Sejfo, für seine Tochter. Jetzt, wo er sie nicht mehr filmen kann, will er ihr wenigstens einen Gruß per Videokassette zukommen lassen. Ausschnitte aus seinem insgesamt vierstündigen Film sind nun das Herzstück von Chiara Sambuchis TV-Dokumentation „Das Srebrenica Tape – Liebesbotschaft aus dem Krieg“.
Die immer noch hellblonde Alisa hat die Kassette bekommen und sich 30 Jahre später entschlossen, in ihre Geburtsstadt zurückzukehren, um nach Sejfos Spuren zu suchen. Nicht mehr viele erinnern sich an ihn, doch als sie mit seinem Freund Gero das Tape anschaut, ist das einer von vielen bewegenden Momenten dieser sehenswerten Fernsehdokumentation.
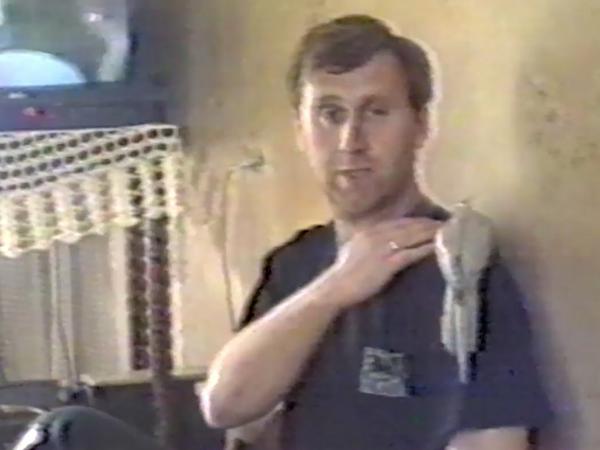
© Sejfudin Smajlović/DOCDAYS
„Wenn wir nicht unter Beschuss waren, wollten wir so normal wie möglich leben,“ kommentiert Gero eine Szene, in der Sejfo mit anderen jungen Männern in einen Fluss springt. Er selbst sei an dem Tag auch dabei gewesen. Später ging er auf die Offizierschule in Zenica und überlebte den Krieg.
Ratko Mladićs Truppen nahmen die Stadt im Juli 1995 ein
Sejfo bemüht sich, seiner Tochter immer wieder solche unbeschwerten Momente zu zeigen, doch das Leid in der Stadt voller zerbombter Häuser und weißer UN-Fahrzeuge kommt ebenso deutlich zum Ausdruck. Etwa wenn er einmal eine Reihe dünner Flüchtlingskinder filmt und aus dem Off kommentiert, dass sie nichts zum Anziehen haben, keine Kekse und keine Schokolade kennen.
Was in und um die Stadt geschah, nachdem sie am 11. Juli in die Hände des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladić und seiner Truppen gefallen war, hat das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag in jahrelangen Prozessen aufgearbeitet. Es hat die Ermordung von über 8000 bosniakischen Jungen und Männern als Völkermord eingestuft und Mladić zudem aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord und Geiselnahme von UN-Personal schuldig gesprochen.
Ein nah an den Ereignissen bleibendes Denkmal hat die bosnische Regisseurin Jasmila Žbanić den Opfern mit ihrem oscarnominierten Spielfilmdrama „Quo vadis Aida?“ gesetzt. Genau wie sie konzentriert sich die Italienerin Sambuchi auf das Schicksal einer Familie, was zu einer großen Identifikation führt, die die abstrakten Zahlen und Daten anschaulich macht. Und es lässt erahnen, wie sich der Horror auch in die Überlebenden eingeschrieben hat.
Einmal besucht Alisa Sejfos Schwester Suada, die mit dem letzten Bus aus Srebrenica entkam und heute in Sarajevo lebt. Einer ihrer Söhne kommt gerade von der Arbeit, gemeinsam schauen sie auf dem Laptop das Video von Sejfo an. Als Suadas Mann dort auftaucht, erkennt man, wie ähnlich sein Sohn ihm sieht. Mit weit aufgerissenen Augen hört er seinem Vater zu – sprechen kann niemand.
Die Mutter und die Oma möchte den Krieg lieber vergessen
Die Verarbeitungsmethode von Alisas Mutter und Großmutter lautet Schweigen und Vergessen. Vor der Kamera über den Krieg zu reden, fällt ihnen sichtlich schwer. Zumal Alisas Eltern sich genau zu dieser Zeit auch noch scheiden ließen. Jetzt hat die 39-Jährige selbst eine Tochter, die etwa in ihrem damaligen Alter ist.
Ihren Opa kennt sie nur aus Alisas Erzählungen und von dem Video, das er für seine Tochter aufnahm. Ihm war währenddessen offenbar klar, dass die Chancen gering waren, sie je wiederzusehen. „Vergiss mich nicht“, sind seine letzten Worte. Den Wunsch hat sie ihm erfüllt.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: