
© Reuters
Countdown zur US-Wahl: Noch 35 Tage: Obamas rhetorische Kneippkur
Barack Obama beruft sich öfter auf Jesus, als George W. Bush es tat. Doch sein Hoffnungs-, Versöhnungs- und Befreiungspathos hat sich verbraucht. Wie kann er im ersten TV-Duell gegen Mitt Romney bestehen?
Stand:
Barack Obama beruft sich öfter auf Jesus, als George W. Bush es tat: So lautet die Überschrift eines Artikels, der im Sommer 2009, ein halbes Jahr nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten, in der Zeitung „Politico“ erschien. Ob in seinen Ausführungen über die Wirtschaft, den Nahen Osten oder das Abtreibungsrecht – gern und oft spielt Obama auf die Bibel und das Christentum an. Vor seiner legendären Rede in Kairo konsultierte der Redenschreiber im Weißen Haus mehrere Geistliche verschiedener Konfessionen. Selbst der Haushaltsplan wurde mit ihnen in einer zweistündigen Konferenz besprochen.
Obamas Rhetorik ist der Schlüssel zu seinem Erfolg und zu seiner Popularität. In welcher Form er von dieser Begabung jetzt Gebrauch macht, wird er im ersten TV-Duell zeigen, das er sich an diesem Mittwoch gegen den Herausforderer der Republikaner, Mitt Romney, liefert. Dabei gilt der Amtsinhaber als Favorit. Romneys Redekunst ist eher unterentwickelt. Er spricht mit einfacher Syntax, wenig Betonung, die Pointen sind berechenbar, es fehlt oft an Anschauung und Konkretion.
Obamas Hoffnungs-, Versöhnungs- und Befreiungspathos indes hat sich verbraucht. Er muss sogar aufpassen, nicht allzu sehr in seine früheren Rollen zurückzufallen. Die Versuchung freilich ist groß. Obama brillierte stets, wenn er den ganz großen Bogen schlug. Wenn er etwa die schwarze Befreiungstheologie ökonomisch übersetzte – die hart arbeitenden Amerikaner von der Unterdrückung durch Wirtschaftslobbyisten befreien.

© Tsp
Oder wenn er an Versöhnungssehnsüchte Lessingscher Dimensionen appellierte – Demokraten sprechen mit Republikanern, Schwarze mit Weißen, Christen mit Muslimen, Amerikaner mit Iranern.
Virtuos beherrscht Obama verschiedene Redestile. Er kann, je nach Bedarf, schwarze Slang-Elemente einfließen lassen, mit dem Publikum in einen Frage-Antwort-Modus wechseln, religiöse Geschichten in säkulare Gefühle übersetzen. Kurz nach dem Parteitag der Demokraten analysierte die „Washington Post“ seine Rede in Charlotte (North Carolina) unter der Überschrift „Yes, Obama has the gift of God talk“.
Damit war insbesondere dessen geschickter rhetorischer Sprung von „Ich“ auf „Du/Ihr“ gemeint. „Es geht nicht um mich. Ihr seid der Wandel. Nur ihr habt die Kraft, das Land nach vorne zu bringen.“ Da klang Moses an, als er dem Volk Israel sagte, selbst ins Gelobte Land gehen zu müssen. Und es erinnerte an den berühmten Satz aus John F. Kennedys Amtseinführungsrede „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst“.
Der Wahlkampf in Bildern:
Die Wirkung solch religiös aufgeladener öffentlicher Reden kann in Amerika groß sein. Für eine Mehrheit von Demokraten und Republikanern ist es wichtig, dass der Präsident einen festen Glauben hat. Als am 28. Januar 1986 nur 73 Sekunden nach ihrem Start die „Challenger“ explodierte, sagte der damalige US-Präsident Ronald Reagan noch am selben Abend: „Wir werden diese Menschen niemals vergessen, wie sie sich an diesem Morgen auf ihre Reise vorbereiteten, uns zuwinkten und die harten Fesseln der Erde abstreiften, um das Gesicht Gottes zu berühren.“ Daraufhin schnellten Reagans Beliebtheitswerte steil nach oben.
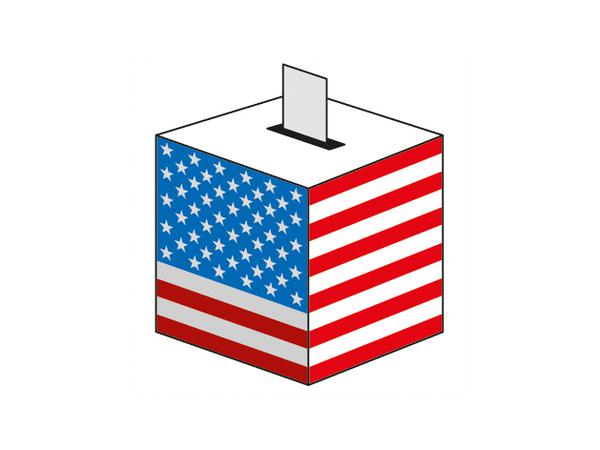
© Tsp
Doch das ist lange her, und 2012 liegen die Dinge anders als 2008. Weil Kritiker dem amtierenden Präsidenten vorwerfen, außer schönen Worten in vier Jahren wenig Substanzielles geliefert zu haben, ist Obama der bloße Rückzug in die Pathos-Rhetorik versperrt. Erneut einen großen narrativen Bogen zu spannen, würde ihm wahrscheinlich als Arroganz ausgelegt. Sein Hang zur professoralen Attitüde steht ihm zusätzlich im Weg. Er muss sprachlich abrüsten, um in Sachen Glaubwürdigkeit aufrüsten zu können. Er muss seine Worte in kaltes Wasser tauchen.
Nur als ruhiger, nüchterner, sachlicher Präsident darf Obama in das erste TV-Duell gehen. Lieber zu trocken als zu klug, lieber zu inhaltlich als zu schlagfertig. Er muss an die Geduld der Amerikaner appellieren und an ihre Fairness, ihm eine weitere Bewährungschance zu geben. Das ist eine bescheidene Botschaft. Stärke durch das Eingeständnis von Schwächen demonstrieren: Auch darin schwingt freilich religiöse Metaphorik mit. Auf die Dosis kommt’s an.
Wie gut kennen Sie die USA? Testen Sie Ihr Wissen in unserem großen Quiz zur Wahl!
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: