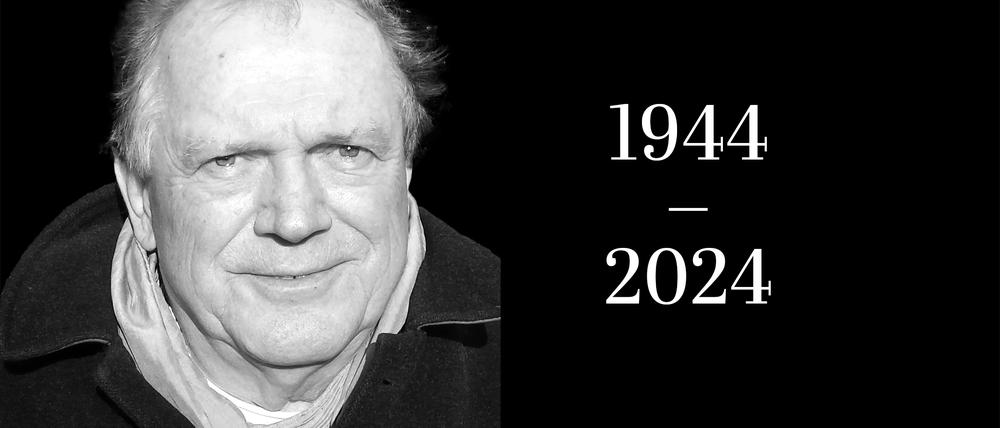
© privat
Nachruf auf Wolf Wagner: Irrtümer haben ihr Gutes
Er war faul und prügelte sich gern - klar, dass er zu den Verlierern gehören würde. Ganz so ist es nicht gekommen
Stand:
Hitler hatte den Krieg verloren, die Nazis hatten ihn gewonnen. So zumindest schien es Wolf Wagner, denn nach der deutschen Kapitulation blieben viele der ehemaligen NS-Funktionäre in Amt und Würden. Selbst etliche Witwen von Kriegsgefallenen trauerten dem „Dritten Reich“ hinterher, und auf den Sonntagsausflügen wurde den kleinen Stammhaltern von strammen Onkeln eingebläut, was es heißt, ein richtiger Mann zu sein. So einer, wie der Vater gewesen war...
Ein weltmännischer Jurist, der in der Weimarer Friedenszeit Freunde allerorten gehabt hatte. Im Krieg hingegen diente er als Aufseher über russische Kriegsgefangene in Norwegen, weil er hoffte, so dem Tod an der Front entkommen zu können. Wolf Wagner erzählt davon in seiner „Autobiografie eines prototypischen Westdeutschen“, die zugleich eine große Beichte ist: „Ein Leben voller Irrtümer“.
Irrtümer haben ihr Gutes. Die Mutter litt zeitlebens an einem starken Zittern. Vor ihrer Ehe wollte sie von den Ärzten wissen, ob sich dieser Tremor vererben würde. Die Ärzte verneinten. Die Mutter gab ihr Ja-Wort. Die Ärzte irrten. Und eben diesem Irrtum verdankte Wolf sein Leben.
Er kam in Tübingen zur Welt, im Haus der Großmutter. Seinen Vater hat er nie gesehen. Der starb, von den Sowjets als Kriegsverbrecher verurteilt, in einem „Entlassungslager“ für nicht mehr arbeitsfähige Gefangene. Wolf war zeitlebens froh, ohne leiblichen Vater aufgewachsen zu sein, denn die Männer seiner Kinderjahre waren zum Fürchten. „Sie redeten mit tiefen, lauten Stimmen, meistens schimpfend, herabsetzend oder im Befehlston.“ Da der Vater fehlte, unternahm es die Mutter, aus Wolf einen richtigen Mann zu machen. Aber sie scheiterte. Auch was seine sittliche Ertüchtigung anbelangte. Im Kindergarten hob er den Mädchen fleißig die Röcke empor. In den Doktorspielen tat er sich als besonders sachkundig hervor, und ein paar Jahre später brachte ihm die Onanie mehr Freude als Gewissensbisse.
Ein unerwarteter Fluchtweg
Dennoch schaffte er es aufs Gymnasium, wo die Lehrer den soldatischen Drill praktizierten, der ihnen zur Auswahl der Besten nötig schien. Die anderen blieben auf der Strecke. Zu den Verlierern würde auch Wolf gehören, dessen waren sich die Lehrer sicher. Er war faul, prügelte sich gern, weil er ständig wegen seines Zitterns gehänselt wurde, und er hörte Jazz Musik, bevorzugt von schwarzen Musikern.
Außerdem verantwortete er die Schülerzeitung, was ihm einen unerwarteten Fluchtweg aus der schwäbischen Provinz eröffnete. Ein Stipendium wurde ausgeschrieben: Als einjähriger Austauschschüler in die USA. Wolfs Glück: Die Gutachter achteten weniger auf seine Noten als auf sein schriftstellerisches Talent. Die Lehrer warnten vor den kulturlosen „Amis“, aber die Mutter stimmte zu.
Die neue Welt schien anfangs noch beengter als die Tübinger Altstadt. Clark in South Dakota, ein kleiner Ort, mitten in Amerika. Schon am dritten Tag wurde Wolf von seinem neuen Dad eine Flinte in die Hand gedrückt und es ging auf Fasanenjagd. Er wurde auf Partys herumgereicht, lernte die Kunst des Small Talk und litt unter schrecklichem Heimweh.
Bis er begriff, dass keiner ihm Böses wollte. Die Lehrer legten es in der Schule darauf an, die Schüler zu fördern und nicht zu dressieren. Er trat dem Debattierclub bei und gewann Freunde, nicht indem er auftrumpfte, sondern indem er Fragen stellte. Wer offen auf die Menschen zugeht, dem öffnen sie sich. Das war seine amerikanische Lektion. Sein Dad, den er auf Lebenszeit als Ziehvater liebgewann, betrieb eine Zeitung, in der Wolf eine Kolumne schreiben durfte: „Andere Völker, andere Sitten“. So lernte er, Unterschiede wahrzunehmen, ohne vorschnell Urteile daraus abzuleiten.
Das verübelten ihm die deutschen Lehrer nach seiner Heimkehr. Sie wollten ihn wieder devot sehen, aber Wolf misstraute fortan Autoritäten. „The pursuit of hapiness“, dieses Grundrecht, in der amerikanischen Verfassung eigens verbürgt, forderte er fortan auch in der Tübinger Heimat ein. Was befremdete, denn das Recht auf Glück ist im Schwäbischen allenfalls als Sünde denkbar.
Entsprechend unfroh war auch die Stimmung im Studium, zu dem Wolf, der noch immer Journalist werden wollte, umstandslos zugelassen wurde. Er hatte gute Abiturnoten, aber keine Ahnung, was auf ihn zukam. Die Studenten siezten einander, trugen Krawatte, nicht wenige noch einen Zipfel am Gürtel, der sie als Mitglied einer schlagenden Verbindung auswies. Alle taten sehr klug und sehr ernst, und am klügsten waren die Professoren in den Geisteswissenschaften. Was sich daran zeigte, dass ihre Vorlesungen über weite Strecken unverständlich waren. Zumindest für die Ungebildeten unter den Studenten, zu denen sich Wolf zählen musste. Bis er die entscheidende Frage stellte: „War die Tendenz zur Unverständlichkeit Absicht?“
Sie war es bei vielen Professoren, denen der Talar mehr Würde gab als angebracht. Aber nur so ließ sich der Anschein der Allwissenheit wahren. Hochstapelei als Prinzip, wie Wolf vermutete. Denn im Grunde war es ein einfaches Rechenexempel: Wenn 50 wichtige Denker 50 wichtige Bücher geschrieben haben, für die jeweils je eine Woche Lesezeit angesetzt wird, dann ist der Student nach Beendigung der Pflichtlektüre im Pensionsalter. Die Professoren waren alle nicht so klug, wie sie taten. Viel Wissen stammte aus zweiter Hand, nicht immer war alles selbst durchdacht.
Die Angst, ein Banause zu sein, weil man Heidegger nicht versteht
Nach und nach verlor er die „Uni-Angst“, zu definieren als die „Angst vor dem schlauen Gesicht“ der anderen. Es war alles nur ein großer Bluff. Aus diesem Verdacht wurde im Lauf des Studiums Gewissheit. Wolf schrieb darüber 1973 einen Aufsatz, der für viel Aufregung sorgte: „Der Bluff – Die Institution der Universität in ihrer Wirkung auf die Arbeitsweise und das Bewußtsein ihrer Mitglieder“. Vier Jahre später wurde ein Buch daraus: „Uni-Angst und Uni-Bluff. Wie studieren und sich nicht verlieren.“ Ein Bestseller, der bei zehntausenden Studenten erheblich die Angst minderte, ein Banause zu sein, nur weil man Adorno oder Heidegger nicht verstand.
Der akademische Jargon war ein Jargon, eine Geheimsprache zwecks Statuserhöhung, diese einfache Wahrheit festzustellen und auch so auszusprechen, wurde Wolf von vielen verübelt. Sein „Manifest für das Recht auf Durchschnittlichkeit“ wurde als ungehöriger Aufruf zur Vereinfachung komplexer Sachverhalte denunziert. Und so hat sich in der universitären Praxis in der Folge auch wenig geändert. Es gilt nach wie vor die möglichst pompöse Gewandung der schlichtesten Gedanken zwecks Erwirtschaftung eines wissenschaftlichen Renommees. Denn Renommee bedeutet Festanstellung bedeutet Pensionsanspruch. Auf den legten auch die Systemgegner größten Wert.
In Fragen der Karriereplanung war Wolf weniger gewieft. Es zog ihn nach Berlin, weil an der Freien Universität Politikwissenschaft auf fortschrittliche Weise gelehrt wurde. Er verteilte Flugblätter gegen die Polizeigewalt anlässlich des Schah-Besuchs, postierte sich dazu mit Anzug und Krawatte auf der Freitreppe der „Freien Volksbühne“, wo das bürgerliche Publikum ihn rüde anpöbelte: „Dich hat man beim Vergasen vergessen.“
Die Demokratie in der Bundesrepublik war gar nicht so demokratisch wie gedacht. So wurde die antiautoritäre Revolte auch seine Revolte, nicht zuletzt, weil sie die sexuelle Revolte mit beförderte. „Es ging darum, eine Gesellschaft ohne Orgasmusschwierigkeit zu schaffen. Dann würde es auch keinen Vietnamkrieg mehr geben können.“ Nicht zwingend logisch, aber vielversprechend, was die praktische politische Arbeit anbelangte. „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment!“
Für Wolf persönlich war die sexuelle Befreiung allerdings ein Albtraum, denn sie ging nicht einher mit der Loslösung von der Mutter, die doch als einzige seiner Liebe wert schien. Er gab sich zwar als „wilder Schmuser“, aber so richtig ernst meinte er es mit keiner Frau, und Vater wollte er schon gar nicht werden. Davor hatte schließlich auch der „Club of Rome“ ausdrücklich gewarnt, nicht vor dem Kinderkriegen an sich, aber vor dem Weltuntergang. Also ließ sich Wolf sterilisieren, aber da seine Orgasmusfähigkeit auch weiterhin unter seiner Zukunftsangst litt, war die Karriereplanung nicht sein vordringlichstes Problem. Wolf promovierte zwar über die Theorie der Verelendung, wurde auch Assistenzprofessor, aber er verausgabte sich in endlosen Komiteesitzungen, in denen so erschöpfend Theorie und Praxis des linken Denkens debattiert wurde, dass für wissenschaftliche Forschung an sich kaum mehr Zeit blieb. Er habilitierte folglich mit gehöriger Verzögerung, sodass er bei der großen Stellenvergabe an den neu geschaffenen Universitäten zu spät kam.
Das war sein Glück, denn das erlaubte ihm noch einmal den Schwenk ins wirkliche Leben. Es war das esoterische Jahrzehnt, die Zahl der Traumata wuchs in den Siebzigern mit der Zahl der Therapien. Sinnsuchende gingen in Scharen auf Tourneen der Selbsterfahrung, räumlich wie seelisch. Die einen fuhren nach Poona, die anderen feierten ihr Rebirthing, mentale Hyperventilation auf allen Kanälen. Wolf sah sich systematisch in diversen Psychoworkshops um und entdeckte das „Rolfing“ für sich, eine Methode der Körperarbeit, bei der mit Einsatz aller Glieder versucht wurde, den Körper des zu Therapierenden so umzumodellieren, dass er im Schwerefeld der Erde wieder optimal ausbalanciert war.
„Marxist sucht Marxistin, die nicht nur das ist“
Das konnte sehr schmerzhaft werden und sehr teuer. Wolf reiste nach Amerika, ließ sich vor Ort im „Rolf Institut“ zum „Rolfer“ ausbilden, kehrte nach Tübingen zurück und begann erneut an sich und der Welt zu zweifeln. Denn in der Liebe fand er kein Glück. Er sah sich als Helfer und Heiler, und suchte doch immer nur sich selbst im Gegenüber: „Was an mir, regt mich so auf an dir?“ Das Rolfing wiederum hätte ihm zwar ein Leben als Therapeut finanziert, aber je länger er es praktizierte, desto weniger war er von seiner Wirkung überzeugt, erst recht als ihn, den Zweifelnden, ein Lehrassistent mit dem Ratschlag abspeiste: „Ich solle einfach so tun, als ob ich rolfen würde.“ Da war er wieder: Der Bluff!
Wolf zog erneut nach Berlin, gab eine Anzeige auf: „Marxist sucht Marxistin, die nicht nur das ist“. Er schlief mit vielen Frauen, fühlte sich „frei wie ein westlicher Stadthirsch“ und streifte doch nur orientierungslos umher, bis er Male traf. Die Liebe seines Lebens.
Bodenständig klug, schön anzusehen und dennoch fähig, über sich selbst zu lachen. Was auch nötig war, denn Wolf glaubte noch immer, sich seine Freiheit bewahren zu müssen, für die er gar keine rechte Verwendung hatte. Bis die Mauer fiel und er einen Lehrauftrag in Erfurt annahm, was ihm in der Folge eine Professur für Sozialwissenschaften und Politische Systeme an der dortigen Fachhochschule einbrachte. Er wurde Prorektor und Rektor und fand eine Lebensaufgabe, denn er wollte anders sein als die „Besserwessis“, die „Kriegsgewinnler“, wie er seinesgleichen nannte, von denen viele es sich rasch bequem machten auf ihren neuen Posten und alle Zweifel an ihrer Kompetenz mit Arroganz abstraften.
Das alles ist in seinen Büchern und Aufsätzen nachzulesen, denn auch nach der Pensionierung gab er keine Ruhe: „Kein Ende mit der Wende“. Aber ein Ende seiner Bindungsunfähigkeit. Nach dem Tod seiner Mutter war er frei für die Liebe. Er heiratete Male und weinte bitterlich über diesen Entschluss, weil er glaubte, den größten Fehler seines Lebens begangen zu haben.
Er irrte und gab es Jahr für Jahr gern zu. So wie er immer freimütig all seine Irrtümer eingestanden hat. Es war ein wenig wie im Märchen. Die beiden bezogen eine schöne Wohnung in Berlin, die sich von Zeit zu Zeit wunderbar tauschen ließ gegen schöne Wohnungen in aller Welt. Sie gingen auf Reisen bis zuletzt, auch wenn die Ziele nicht mehr ganz so fern lagen. Für Sport hatte er noch immer keine Zeit, denn es gab viel nachzudenken, auch wenn es ihn tieftraurig machte, mitanzusehen, wie die Mächtigen der Welt die Menschen um ihr Glück betrügen. Er blieb im Herzen das Kind aus dem Märchen, das mutig den stolzierenden Kaiser bloßstellt, der aller Einbildung zum Trotz doch nur ein erbärmlicher Nackedei ist.
- Der Weltuntergang
- Geisteswissenschaften
- Hochschulen
- Kunst in Berlin
- Lehrer
- Nachrufe
- Norwegen
- Schule
- USA
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: