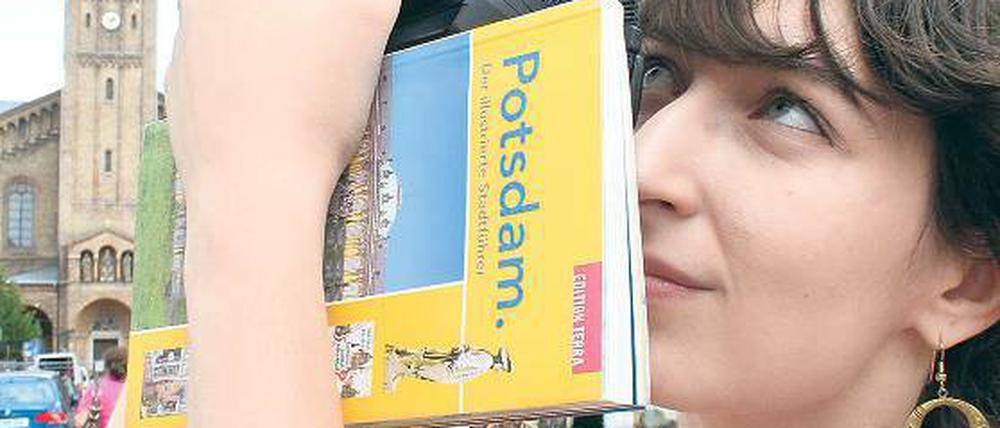
© Andreas Klaer
Von Anna Mageras: Besondere Pilze à la carte
Verwunschene Orte, Wohlstandsunterschiede und Sprachbarrieren – persönliche Eindrücke einer US-Amerikanerin in Potsdam
Stand:
„Do you speak English?“, frage ich. „Nein“, antwortet die Apothekerin und blinzelt mich durch ihre dicken Brillengläser an. Also summe ich wie ein Insekt und ahme mit den Händen Flügelgeflatter nach. Schließlich stoße ich mit dem Zeigefinger wiederholt auf meinen Arm und sage „Ouch!“ – „Aha!“ Meiner Zuschauerin geht ein Licht auf und sie zaubert eine kleine Tube herbei. Leider merke ich erst nach dem Verlassen der Apotheke, dass sie mir statt der erwünschten Bienenstichsalbe ein Mückenabwehrmittel verkauft hat.
Als Amerikanerin allein in Potsdam unterwegs fällt mir die Kommunikation schon schwer. Anders als in Berlin, Frankfurt oder München spricht hier nicht jeder Zweite gutes Englisch, sondern höchstens ein paar Worte. Sogar in einer Buchhandlung mit einer Auswahl an englischen Büchern reagiert die Verkäuferin auf meine Anfrage nach dem nächsten Schreibwarenladen bloß mit einem verlegenen Lächeln.
Im Restaurant sitzt jeder ohne Deutschkenntnisse auch erstmal verdutzt vor den absatzlangen Speisebeschreibungen. Da winkt der deutsche Kellner rasch seine japanische Kollegin herbei. Ich bestelle auf ihre Empfehlung hin vertrauensvoll die „special mushrooms“ („besondere Pilze“) und genieße dann erleichtert die damit gemeinten Pfifferlinge, Englisch „chanterelles“.
Trotz der Sprachbarriere sind die Menschen hier hilfsbereiter als in den Großstädten und lassen sich durch mein Englisch nicht aus der Fassung bringen. Als ich einen Busfahrer frage, wie lange meine Fahrkarte noch gültig ist, schaut er geduldig auf seine Uhr, zählt auf einer Hand nach und malt mit dem Zeigefinger die Zahl 50 in die Luft. Wenn ich in Berlin um Auskunft bitte, schnauzen mich Busfahrer öfter an, sie hätten keine Zeit dafür: „Ich hab sowieso schon zwei Minuten Verspätung!“ Amerikanern ist dieser Drang zur Pünktlichkeit unverständlich. „Take a chill pill!“ („Nimm mal ’ne Beruhigungs-Tablette!“), lautet eine beliebte Ermahnung in den Staaten.
Das Klima in Potsdam ist da eine Wohltat nach dem Aufenthalt in der Bundeshauptstadt. Alles läuft hier entspannter: die Autos, die Fahrräder, die Fußgänger. Besonders charmant sind die in Kniehosen, bestickten Westen und Dreispitz kostümierten Männer, die beim Eingang zum Park Sanssouci die Gäste begrüßen und regelmäßig gemütliche Zigarettenpausen machen.
Natürlich wirkt Potsdam wegen alledem nicht so aufregend wie seine größere Schwester Berlin. Wenn Berlin dazu verdammt ist, immer zu werden und niemals zu sein, dann scheint es dem Besucher auf den ersten Blick, als gelte für Potsdam das Gegenteil.
Wer vom Hauptbahnhof schnurstracks ins historische Zentrum fährt und von dort aus nach Sanssouci marschiert, kann sich wunderbar im märchenhaften Ambiente verlieren. Die alte Stadtmitte und vor allem der Schlosspark wirken wie verwunschene Orte, die mit Dornröschen vor Jahrhunderten eingeschlummert sind und erst langsam beginnen, sich den Sand aus den Augen zu reiben.
Erst, als ich die langen Treppen zum Schloss Sanssouci empor geklettert bin und mich wende, um wie Königin Luise einen majestätischen Blick über die Lande zu werfen, entdecke ich einen Fehler: Drei riesige, graue Plattenbauten ragen aus dem Grün hervor in den Himmel hinein.
„Wer hat so etwas veranlasst? Wer hat das erlaubt?“, frage ich entsetzt einen nebenstehenden amerikanischen Touristen. Der zuckt mit den Achseln und meint, „aber die in den oberen Stockwerken da haben ’ne fantastische Aussicht“.
Diese Landschaftsmakel führen mich zu einer peinlich späten Erleuchtung: Potsdam ist eine ostdeutsche Stadt. Ich bin zuerst erleichtert, als andere Amerikaner zugeben, dass sie sich der DDR-Vergangenheit der Stadt auch nicht bewusst waren. „Potsdam ist einfach so hübsch“, sagt ein Mann aus Neu Mexiko. „Da denkt man nicht an die DDR.“ Eine Frau aus Virginia schwärmt: „Wenn man im Café im Drachenhaus oder am Nauener Tor sitzt, dann fühlt man sich fast so wie in Disneyland!“ Außerdem liegt Potsdam so nah an Westberlin, dass man meinen könnte, es habe mit zum Westen gehört.
Andererseits erschüttert mich diese Wissenslücke. In den USA lernt man in der Schule nur selten Genaueres zur deutschen Geschichte zwischen 1945 und 1989. Potsdam taucht im Unterricht höchstens im Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen Truman, Churchill und Stalin auf.
In den amerikanischen Reiseführern steht auch nichts zum sozialistischen Regime. Nicht einmal die Glienicker Brücke wird als Sehenswürdigkeit hervorgehoben, obwohl sie als „Bridge of Spies“ (Brücke der Spione) durchaus das Interesse des Amerikaners wecken dürfte.
Auf einen persönlichen Tipp hin suche ich das ehemalige Stasigefängnis in der Lindenstraße auf. Ohne Stadtplan und ohne Deutsch ist es nahezu unmöglich zu finden und der Mann an der Museumskasse kann auch nichts mit meinem „One student please“ anfangen. Touristen aus den Staaten scheinen tatsächlich nur selten hier zu landen.
Als ich mich durch die unscheinbare Tür begebe, fühle ich mich sofort von der Außenwelt abgeschlossen. Ich bin die einzige Besucherin und es herrscht eine beklemmende Stille, die nur von dem Gurren und Flattern der Tauben auf dem Dach gebrochen wird. Das trübe Grau des Himmels spiegelt sich in den Steinwänden wider und Reihen von vergitterten Fenstern starren bedrohlich auf den Innenhof. Im Innern des Gebäudes schleiche ich die Gänge entlang und erfahre ganz irrationale Ängste, dass ich in einer Zelle eingesperrt werden könnte.
In einem Haftraum erklingt die Stimme eines Mannes, der sich an seine Gefangenschaft vor kurzen 25 Jahren zurückerinnert. Er habe während seiner Zeit hier keinen Namen getragen, sondern nur eine Zahl. Seine Stimme geht mir unter die Haut. Sie stellt eine menschliche Gegenwart dar, die die zeitliche und räumliche Nähe der beschriebenen Begebenheiten verdeutlicht. An diesem Ort verschwindet die Distanz zur Geschichte – selbst für die unwissende Amerikanerin.
Als ich zurück auf die Straße trete, füllen Kindergeschrei und Cafégeplauder meine Ohren und bunte Schaufenster funkeln mich verlockend an. Ich brauche ein paar Minuten, um den Kontrast zwischen drinnen und draußen, gestern und heute zu verdauen.
Ich fahre weiter mit der Tram durch Schlaatz bis ins Wohngebiet Stern . Auffallend sind sofort die hohen, tristen Gebäude, die abblätternde Farbe an den Wänden, der obdachlose Zeitungsverkäufer und die Müllhäufchen, die vom Wind den Gehsteig entlang gefegt werden. Ich suche Ähnlichkeiten zu etwas Bekanntem und lande in Gedanken bei Ecken der New Yorker Bronx.
Doch der Vergleich gelingt nur annäherungsweise, denn Am Stern gibt es ziemlich viele Bäume, einen guten Supermarkt und sogar ein Massagestudio. Zugegeben ziert Graffiti die Häuschen in den nahe gelegenen Schrebergärten, aber immerhin stehen sie den Einwohnern zur Verfügung. Solcher Luxus ist in der Bronx schwer zu finden.
Dennoch weist Potsdam Wohlstandsunterschiede auf, die ich sonst nur vom schonungslos kapitalistischen Amerika gewöhnt bin. In einer deutschen Stadt erstaunt mich der gewaltige Gegensatz zwischen den Villen am Griebnitzsee und den Plattenbauten in Drewitz.
Zurück im Zentrum öffne ich meine Augen nun immer mehr den Zeichen modernen Lebens, die zwischen den architektonischen Merkmalen der preußischen und sozialistischen Vergangenheiten hervorsprießen: Tattoo-Salons und sozialkritische Buchhandlungen, afrikanische Trommelspieler und Jazzsaxophonisten, Starbucks Cafés und eine geplante Synagoge. Ich erkenne eine sich hier entwickelnde moderne Identität und merke immer mehr, die ursprüngliche Vermutung stimmt doch nicht: Potsdam war und ist nicht nur, sondern Potsdam wird auch.
Die Autorin Anna Mageras stammt aus New York und weilt als Austauschstudentin in Berlin. Für ihre PNN-Reportage „vergaß“ sie für wenige Stunden ihre exzellenten Deutsch-Kenntnisse.
Anna Mageras
- Insekten
- Potsdam: Am Stern
- Potsdam: Brandenburger Vorstadt
- Schloss Sanssouci
- Schule
- Schule und Kita in Potsdam
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: