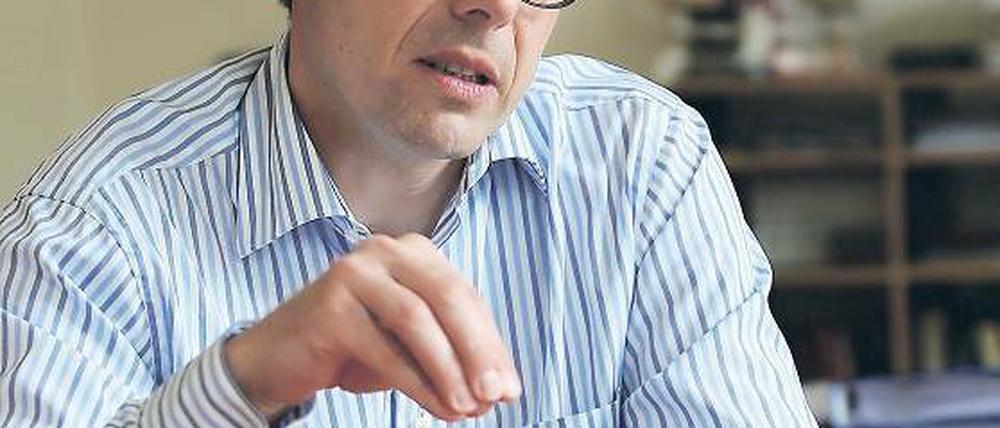
© Andreas Klaer
Homepage: Kunsthistorie von der Kanzel
Hartmut Dorgerloh beim Hochschulgottesdienst
Stand:
Es gibt selten Momente, in denen man spürt, dass Potsdam auch eine lebendige Hochschulstadt ist. Aber an den Abenden in der Friedenskirche Sanssouci, wenn sich das Gotteshaus mit Studierenden, Lehrenden sowie Gläubigen oder Nur-Interessenten füllt, kann man solche Augenblicke erleben. Die ökumenischen Hochschulgottesdienste, veranstaltet von der evangelischen Studierendengemeinde sowie der Katholischen Studentengemeinde, sind spannende Treffpunkte, in denen die Fragen des Lebens und der Religion ins Spannungsfeld verschiedener Meinungen gesetzt werden.
Bekannte Wissenschaftler, zumeist von der Universität Potsdam, sind zu „Predigten“ eingeladen, deren Themen in ihren Fachbereichen liegen. „Prediger“ am vergangenen Sonntag war der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Hartmut Dorgerloh. Mit einem pastoralen Kanzelauftritt, der heutzutage fast altmodisch wirkt, sprach er vor 200 Zuhörern über „Antikes Götterleben und christliches Gottesbild in Sanssouci“. Also ein Thema, das für ihn wohl ein Heimspiel war.
Auch die Bibel steht als Ausgangspunkt für den Hochschulgottesdienst. Diesmal das 14. Kapitel der Apostelgeschichte. Nachdem die Apostel Paulus und Barnabas wegen ihrer Wunder in Lystra für Aufsehen sorgten, meinte das Volk, die Götter seien den Menschen gleich geworden und zu ihnen vom Himmel gekommen. Und nannten Barnabas Jupiter und Paulus Merkur. Die aber weigerten sich vehement gegen solcherlei Vergötterung, denn die Verkündigung des Evangeliums machten sie sich zur Lebensaufgabe.
Natürlich ist das einer theologischen Deutung wert, doch Dorgerloh blieb in seinem ureigenen Metier, der Kunstgeschichte. Die antike und weithin auch heitere antike Götterwelt siedelt man gern in der Geisteswelt Friedrichs des Großen an, die frommen Apostel könnte man mit dem zutiefst gläubigen Christen Friedrich Wilhelm IV. in Verbindung bringen. Der fühlte sich als ein König von Gottes Gnaden. Von seinem Vorgänger Friedrich weiß man dagegen kaum etwas, wie es mit seiner ganz persönlichen Glaubenssicht aussah.
„Ich kenne Gott nicht, aber ich bete ihn jeden Tag auf Vorschuss an“, soll der König gesagt haben. Er hat in keines seiner Schlösser Hofkapellen bauen lassen. Wenn er seine wenigen Kirchen errichten ließ, dann verfolgte er mit ihnen zumeist politische Ziele. Sie hatten auch die Form eines Pantheons, in dem alle Götter Raum finden. In Friedrichs Bibliotheken findet man keine christlichen Erbauungsschriften, dafür ist die antike Götterwelt in unzähligen Büchern von Dichtern versammelt. Friedrich sah sich gern auch als Ganymed. Der Sohn des trojanischen Königs Tros, der „Schönste aller Sterblichen“ wurde von Zeus geliebt und in den Olymp aufgenommen. Im Deckengemälde des oberen Festsaals des Neuen Palais ließ sich Friedrich als Ganymed darstellen.
König Friedrich Wilhelm IV. und seine Frau Prinzessin Elisabeth waren ganz im christlichen Glauben verwurzelt. Doch es fehlte ihnen im Park Sanssouci ein Gotteshaus. „Es scheint mir passend, eine Kirche, welche zu einem Pallastbezirk gehört, welcher den Namen Sanssouci, ,ohne Sorge‘ dem ewigen Friedefürsten zu weihen und so das weltlich negative ,Ohne Sorge‘ dem geistlich positiven „Frieden entgegen – oder vielmehr gegenüber zu stellen.“ Die Friedenskirche wurde erbaut. Er war der festen Überzeugung, dass der Glaube eine ganz persönliche Angelegenheit jedes einzelnen Menschen ist, jeder solle nach seiner „Facon selig“ werden. In diesem Wunsch schwang nichts Gleichgültiges mit, wie wir es von seinem Vorfahren kennen. Klaus Büstrin
Mit den „Gestalten des Unsichtbaren“ in der Kunst beschäftigen sich die Vorträge im Rahmen des Hochschulgottesdienstes im Wintersemester 2012/13. Am 3. Februar: „Moderne Kunst zwischen Markt und Transzendenz“, Friederike Sehmsdorf, Galeristin Kunst-Kontor Potsdam, 18 Uhr, Friedenskirche Potsdam, Allee nach Sanssouci.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: