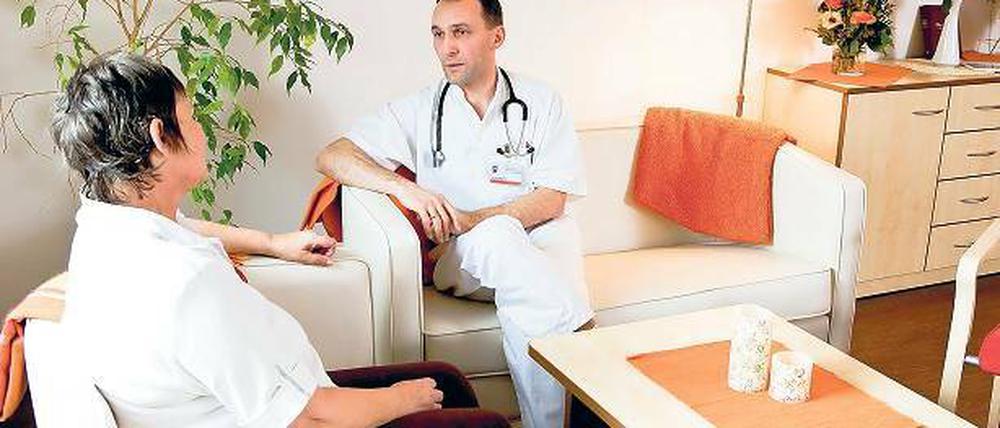
© Bergmann-Klinikum
Landeshauptstadt: Was Worte ausmachen
Kein Ersatz für ein Hospiz: Die Palliativstation des Bergmann-Klinikums arbeitet seit Ende 2008
Stand:
Im Wohnzimmer gibt es eine helle Sofaecke, auf dem Klavier steht ein Kerzenleuchter und eine dieser altmodischen, geschwungenen Tischuhren. Anderswo im Krankenhaus heißt dieser Raum „Aufenthaltsraum“. Aber, sagt Bernd Himstedt-Kämpfer: „Man kann gar nicht überschätzen, was Worte manchmal ausmachen.“ Die Zeit scheint ein bisschen langsamer zu vergehen auf der Station H4 des Klinikums „Ernst von Bergmann“. Vielleicht auch, weil vielen der Patienten hier nicht mehr viel Zeit bleibt. Seit Ende 2008 gibt es die Palliativstation jetzt, bis zu acht schwer- oder todkranke Menschen betreut Stationschef Kämpfer mit seinem Team hier.
Dass er das häufigste Vorurteil über seine Arbeit mittlerweile zumindest von den Arzt-Kollegen nicht mehr hört, wertet Kämpfer als großen Erfolg. Die Palliativstation sei nicht die „letzte Station“, kein Ersatz für ein Hospiz, betont er: „Mehr als 50 Prozent unserer Patienten können nach dem Aufenthalt wieder nach Hause.“ Immerhin: Jeder dritte stirbt auch auf der Station, die übrigen Patienten werden in Hospize, beispielsweise nach Wannsee oder Lehnin, vermittelt. „Wir warten seit unserer Eröffnung auf das Hospiz in Potsdam“, sagt Kämpfer. Mit der Grundsteinlegung am Montag auf Hermannswerder (PNN berichteten) rückt das nun in greifbare Nähe.
Als „Hilfe in Krisensituationen“ versteht Kämpfer die Palliativarbeit. Anlass für die Aufnahme auf der Station können körperliche Beschwerden wie Atemnot oder Schmerzen sein. Es gäbe aber auch viele Fälle, in denen den Patienten wegen einer schweren Krankheit von Angst überwältigt werden, in denen das soziale Netz reißt oder Angehörige die kräftezehrende Pflege einfach nicht mehr schaffen.
Auf der Palliativstation sollen die Patienten wieder stabilisiert werden: „Ziel ist die Entlassung in die gewohnte Umgebung“, erklärt der Stationschef. Deswegen werde auch so schnell wie möglich geklärt, wie die weitere Versorgung organisiert werden kann. Zunächst mit dem Patienten selbst, im zweiten Schritt mit den Angehörigen, die auf Wunsch auch auf der Station übernachten können. 10 Tage bleiben die Patienten im Durchschnitt, 2010 gab es 244 Aufenthalte von 170 Patienten. Über fehlende Belegung musste sich Kämpfer bisher keine Sorgen machen: Es gäbe Überlegungen, die Station auf zwölf Plätze zu erweitern.
20 Mitarbeiter sind für die Station tätig: neben Ärzten und Pflegekräften auch ein Psychologe, Seelsorger, Sozialarbeiter, Pysiotherapeuten. Darüber hinaus habe sich eine gute Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Hospizdienst entwickelt, sagt Kämpfer. Alle 14 Tage laden die Ehrenamtler zum Patientencafé ins „Wohnzimmer“ ein, einmal im Jahr gibt es zudem eine Gedenkfeier für die Verstorbenen. „Wir sind sehr froh, dass das so klappt“, betont Kämpfer.
Seit es die Palliativstation gibt, sei es auch für die Kollegen im Klinikum leichter geworden, über den Umgang mit schwerstkranken Patienten zu sprechen, hat er außerdem festgestellt. Anfragen um Rat von anderen Stationen seien mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Das freut Kämpfer: „Wir wollen noch stärker ins Klinikum hineinwirken“, sagt er.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: