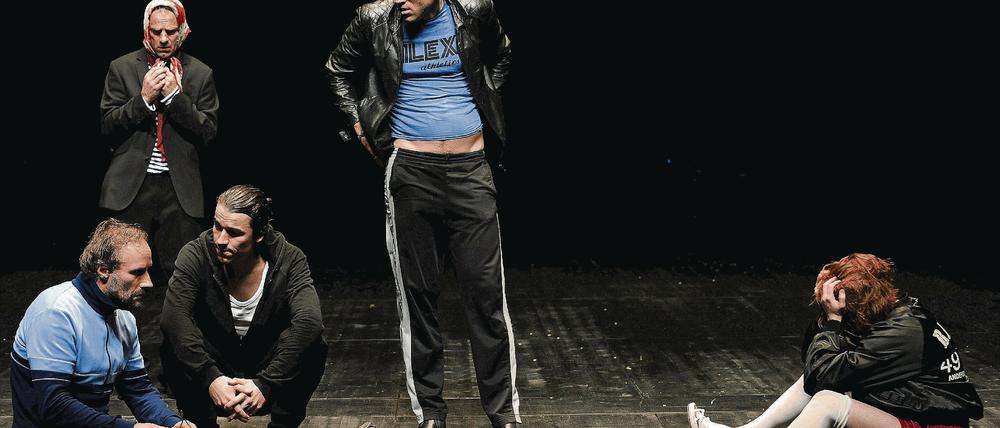
© Demian/dpa
Homepage: „Wir brauchen keine Aggression“
Die Potsdamer Sozialpsychologin Barbara Krahé über Vergewaltigung, Mediengewalt und Cyberbullying
Stand:
Frau Prof. Krahé, Sie haben sich in zahlreichen Studien mit dem Thema Aggression auseinander gesetzt. Stimmt es, dass Männer das aggressivere Geschlecht sind?
Das kann man sagen. Es gibt einen konsistenten Geschlechtsunterschied in Bezug auf die unterschiedlichsten Formen der Aggression. Pauschal gesagt ist Aggression eher ein männliches Verhaltensmuster. Aber man muss auch sagen, dass der Unterschied nicht so groß ist, wie landläufig angenommen. Es gibt aktuelle Ergebnisse, dass Mädchen verstärkt aggressives Verhalten zeigen. Hier scheint sich in Bezug auf den Geschlechterunterschied etwas zu ändern.
Liegen die Ursachen für männliche Aggression in der Biologie oder im sozialen Umfeld?
Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass Aggression durch soziales Lernen, das heißt über Belohnung und die Beobachtung von Modellpersonen erworben und verstärkt wird. Bei der Frage der Hormone – etwa dem Testosteronspiegel – ist die Befundlage nicht so eindeutig. Es gibt zwar im Jugendalter bei Jungen einen starken Anstieg des Testosteronspiegels und auch eine Zunahme der Aggression, aber der kausale Zusammenhang ist nicht eindeutig geklärt.
Sind Frauen anders aggressiv?
Die gängige Vorstellung, dass Frauen auf andere Art und Weise aggressiv sind, wird durch die Forschung nicht gestützt. Es ist zwar richtig, dass Männer eher physisch aggressiv sind, aber dass umgekehrt Frauen mehr indirekte Aggression zeigen, etwa indem sie Andere ausgrenzen oder Gerüchte über sie verbreiten, ist nicht durchgängig belegt. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch in Bezug auf indirekte und verbale Aggression Männer stärker vertreten sind.
Sie haben neue Ergebnisse zur sexuellen Gewalt.
Ich habe mit einer britischen Kollegin eine Studie dazu erstellt, was mit den Fällen sexueller Gewalt geschieht, die bei der Polizei angezeigt werden. In England zum Beispiel münden nur fünf Prozent aller Vergewaltigungen, die bei der Polizei angezeigt werden, in einer Verurteilung des Täters. In Deutschland liegt die Zahl höher, die Verurteilungsrate liegt bei etwa 25 Prozent der angezeigten Fälle. Ein wichtiger Faktor für die hohe Schwundquote im Laufe des Strafverfolgungsprozesses sind Vorurteile.
In welcher Art?
Eine weit verbreitete Vorstellung besagt, dass Frauen sich eine Vergewaltigung selbst zuzuschreiben haben. Und auch das Vorurteil, dass es sich nur um eine „echte“ Vergewaltigung handelt, wenn dabei ein Fremder das Opfer mit einer Waffe bedroht, wird von vielen Menschen geteilt. Dabei kommt gerade dieses Szenario verhältnismäßig selten vor, viel häufiger sind Vergewaltigungen in der Familie, zwischen flüchtigen Bekannten, Nachbarn oder Ex-Partnern. Wenn eine Frau sagt, ihr Ex-Freund habe sie vergewaltigt, wird ihr oft nicht geglaubt. Unser Fazit: je enger der Bekanntschaftsgrad, desto höher die Verantwortung, die der Frau zugeschrieben wird, auch dann, wenn der Täter körperliche Gewalt angewendet hat.
Was wissen Sie über den Zusammenhang von Medien und Gewalt?
Wir wissen beispielsweise, dass der regelmäßige Konsum von Gewaltmedien dazu führt, dass Menschen weniger stark mit Angst reagieren, wenn sie erneut mit Gewalt konfrontiert werden. Wir gehen davon aus, dass der Konsum von Mediengewalt ein Risikofaktor für Aggression ist. Je häufiger man mit Gewalt konfrontiert wird, auch in der virtuellen Realität, desto schwächer wird die natürliche Angstreaktion. Es werden andere Emotionen freigesetzt, etwa Spaß am Töten im Computerspiel, was sich wiederum in einer erhöhten Aggressionsbereitschaft fortsetzen kann.
Wie messen Sie das?
Wenn wir Probanden, die habituell ein hohes Maß an Mediengewalt konsumieren, einen kurzen Gewaltfilm zeigen, fällt ihre Angstreaktion – zum Beispiel gemessen über die Hautleitfähigkeit – schwächer aus als bei Personen, die weniger an Mediengewalt gewöhnt sind. Unsere Probanden bearbeiten nach einem Gewaltfilm verschiedene Aufgaben, um die Effekte der Gewaltdarstellung zu erfassen. Zum Beispiel müssen sie möglichst schnell sagen, ob eine bestimmte Buchstabenkombination ein sinnvolles Wort ergibt. Diejenigen, die an Gewaltdarstellungen gewöhnt sind, können nach dem Konsum eines solchen Films schneller Wörter mit aggressivem Inhalt erkennen.
Jemand, der viele gewalttätige Filme anschaut, würde also schwächer auf reale Gewalt reagieren?
Er oder sie würde weniger Mitgefühl mit Opfern realer Gewalt zeigen. Die Wahrscheinlichkeit der Hilfeleistung wäre ebenfalls geringer. Das zeigen auch andere Untersuchungen. Menschen, die viele „Ballerspiele“ spielen, reagieren auf Gewaltdarstellungen mit geringerer Gehirnaktivität, was ein Hinweis auf Abstumpfungseffekte ist. Dennoch: Niemand behauptet, dass Medienkonsum der einzige Risikofaktor für Aggression ist.
Welche präventiven Maßnahmen bieten sich auf diesem Gebiet an?
Hier steht die Forschung noch am Anfang. Wir erproben in Potsdam gerade ein Medienkompetenztraining für Jugendliche, das einen verringerten Konsum von Gewaltmedien zum Ziel hat. Ein zweites Ziel ist es, den jugendlichen Nutzern zu zeigen, in welchen verschieden Formen Mediengewalt auftritt und wie sie wirkt. Schließlich gehört es auch zu dem Programm, ein Medientagebuch zu führen, um sich den eigenen Konsum vor Augen zu führen. Die Teilnehmer sind oft erschrocken, wenn sie sich vergegenwärtigen, in welchem Umfang sie Gewaltmedien konsumieren.
Die Sozialpsychologie betrachtet nun ganz neue Felder der Aggression.
Das Thema Cyberbullying ist ein neues Thema. Dabei geht es um das Drangsalieren von Anderen im Internet oder mithilfe elektronischer Medien. Die Frage ist, ob es sich hier um ein neues Phänomen oder nur um ein neues Werkzeug für ein altes Verhalten handelt. Macht es einen Unterschied, ob hinter dem Rücken schlecht über jemanden gesprochen wird, oder ob dies im Internet oder per SMS stattfindet? Ich denke, es handelt sich um das gleiche Phänomen, man bedient sich nur anderer Instrumente.
Hand aufs Herz, ein klein wenig Aggression gehört doch zum Leben dazu.
Die Sozialpsychologie definiert Aggression als Verhalten, das mit der Absicht ausgeführt wird, eine andere Person zu schädigen. Nach dieser Definition braucht eine Gesellschaft keine Aggression. Ich würde mir ein Zusammenleben wünschen, in dem die Menschen nicht motiviert sind, anderen zu schaden. Auch wenn es eine Utopie ist, sollte eine aggressionsfreie Gesellschaft unser Ziel sein. Wir alle sollten uns bemühen, Konflikte auf friedliche Weise zu lösen.
Ein weiter Weg
Die fundamentale Frage, was Menschen dazu bringt, aggressives Verhalten zu zeigen und Konflikte mit Gewalt zu lösen, müsste umfassend geklärt sein. Schließlich lässt sich aggressives Verhalten schon bei Kleinkindern beobachten. Bis zu einem gewissen Maße ist es uns also angeboren und muss durch Erziehung abgemildert werden. Die Ursachen für Aggression lassen sich nicht an einem einzigen Bedingungsfaktor festmachen. Wir müssen verstehen, unter welchen äußeren Bedingungen bestimmte Individuen anfällig dafür sind. Es gibt ganz sicher Wechselwirkungen zwischen dem Individuum, der Gesellschaft und dem unmittelbaren sozialen Umfeld.
Das Gespräch führte Jan Kixmüller
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: