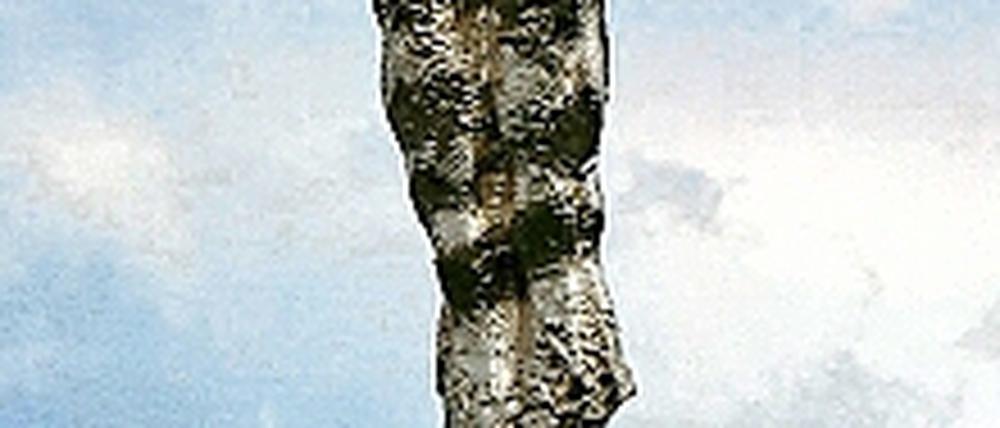
© Andreas Klaer
Von Jan Kixmüller: Wunden der Würde
Die Universität Potsdam ehrt den Brandenburger Künstler Wieland Förster mit der Ehrendoktorwürde
Stand:
Das Intermezzo hatte es in sich. Ein junger Mann nahm hinter einem Mischpult Platz, zog Jackett und Uhr aus und begann gewissenhaft an den Reglern zu drehen. Zu hören waren Fragmente von Beethovens Klaviersonaten, Gesprächsfetzen, Jazzklänge. Die Klavierparts dengelten in unwirkliche Höhen, auf manchem Gesicht der Zuhörer zeichnete sich blankes Entsetzen ab. Andere hingegen schmunzelten amüsiert über die Dekomposition „B“ von Simon Winston. Im viel zu engen Senatssaal der Uni Potsdam war es mittlerweile so stickig wie in einem überfüllten Vorortzug.
Unwillkürlich kam einem wieder das Wort „Geschundenheit“ in den Sinn. Es stand im Zentrum der Worte von Prof. Dieter Mersch vom Institut für Künste und Medien, der gestern Mittag zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an den Bildhauer und Maler Wieland Förster sprach. In Försters Arbeiten gehe es stets um den „Körper im Schmerz, um Versehrtheit und die Wunden der Seele, aber auch um Lust und Leidenschaft“. Mit einem Wort gehe es um den ganzen „existenziellen Kreis zwischen Leben und Tod“. Im Werk des international renommierten Künstlers spiegele sich die Bestialität des vergangenen Jahrhunderts wider, die Ohnmacht und das Ausgesetztsein des Menschen. So gesehen sei das Werk des aus Dresden stammenden Wahlbrandenburgers zutiefst humanistisch, zeige es doch unverhohlen die Wunden des Lebens, aber auch die Leidenschaft und die Würde. Gerade diese Unantastbarkeit der Menschenwürde sei es, die die Wunden von Försters Skulpturen ausdrücken würden.
Wieland Förster, der am 12. Februar seinen 80. Geburtstag feiert, hat diese Wunden am eigenen Leibe erfahren. Gerade mal 15-jährig erlebte er, wie seine Heimatstadt Dresden im Bombenhagel zerfiel, dann sperrte ihn die sowjetische Besatzungsmacht wegen angeblichem Waffenbesitzes für vier Jahre in Bautzen ein. 1950 kam er durch eine Amnestie frei und arbeitete als technischer Zeichner, bevor er Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studierte. Allerdings, wie sein Laudator Heinz Schönemann betonte, ohne von seinem Betrieb dafür delegiert gewesen zu sein. Er habe sich zum richtigen Zeitpunkt selbst delegiert, sagte der ehemalige Stiftungskonservator der Preußischen Schlösser und Gärten. „Ein Zeichen von Größe.“
Eine Größe, die jemand auch haben musste, der jahrelang in der DDR aus ideologischen Gründen mit Ausstellungsverboten belegt war. Erst Ende der 1970er Jahre widerfuhr Förster aufgrund der Unterstützung von Franz Fühmann und Konrad Wolf allgemeine Anerkennung, zahlreiche Preise folgten. Von 1979 bis 1990 war Förster dann Vizepräsident der Akademie der Künste der DDR und dort für die Ausbildung von Meisterschülern verantwortlich.
Geblieben ist dem Bildhauer eine Skepsis, die sich aus seinen persönlichen Erfahrungen speist. Eine Skepsis, die auch dem neuen System entgegenschlägt. So trägt sein Vereinigungsdenkmal „Nike89“ an der Glienicker Brücke in Potsdam durchaus auch Züge von Zerstückelung und Geschundenheit. Gerade diese „Möglichkeiten des Symbolismus“ sind es, die nach den Worten von Dieter Mersch dem Werk des Bildhauers auch eine argumentative und philosophische Seite beifügen. Das Werk erhalte so eine Selbstreflexivität, die es durchaus rechtfertige, dem bildenden Künstler in einem akademischen Rahmen die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Habe der heute in Wensickendorf bei Oranienburg lebende Förster doch immer auch versucht, mit seinem Werk Zeugenschaft abzulegen. Ein Versuch, der in der Kunst durchweg auch durch seine Unmöglichkeit charakterisiert sei. „In dem Wagnis, diese unmögliche Zeugenschaft dennoch einzugehen, zeigt sich die große Tiefe in Försters Arbeit“, resümierte Mersch.
Eine Erklärung für den Widerstandsgeist des auch mit 79 Jahren noch äußerst agilen Künstlers hatten sein Laudatoren schließlich auch. Bildhauern werde eine große Widerstandskraft nachgesagt, merkte Heinz Schönemann an. „Vielleicht weil sie sich an ihrem Material geübt haben, zu widerstehen“.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: