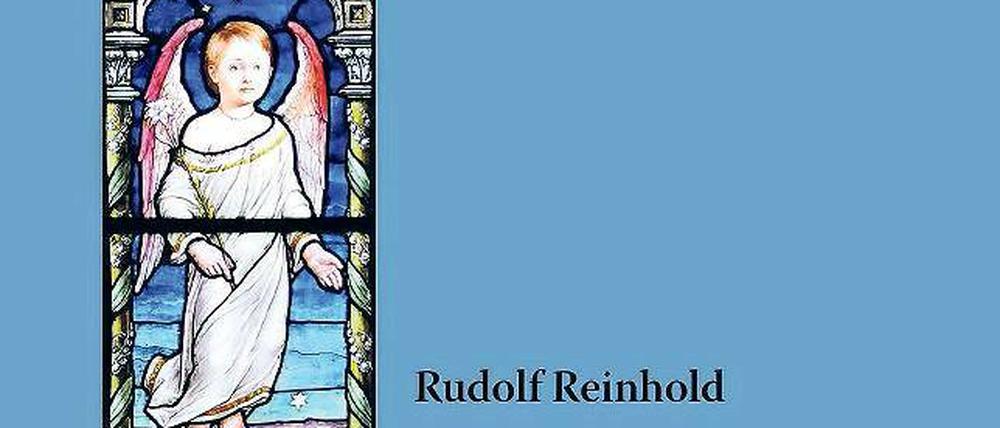
© Rudolf Reinhold
Pfingstkirche: Die Heilige und der Henkersknecht
Rudolf Reinhold erzählt über die Glasmalereifenster der Pfingstkirche ein Stück Zeitgeschichte.
Stand:
Am späten Nachmittag des 26. November 1918 besuchte Auguste Victoria, die letzte deutsche Kaiserin, die Pfingstkirche. Vom quirligen Stadtleben abseits gelegen, die Stille genießend, wollte sie noch einmal Gottesdienst in ihrer geliebten Kirche feiern und Abschied von ihren Getreuen und von Potsdam nehmen. Ihrem Mann, dem Kaiser, folgte sie in der kommenden Nacht ins Exil nach Holland. Am 8. November wurde die Monarchie in Deutschland gestürzt.
Ohne den gewohnten bombastischen Auftritt, es gab ja keinen Hofstaat mehr, betrat sie die Kirche, für deren Bau sie 24 Jahre zuvor die Schirmherrschaft übernahm und aus ihrem Privatmögen Geld spendete. Natürlich nahm sie noch einmal im königlichen Gestühl Platz. Ob Auguste Victoria in dieser Stunde wohl auch Augen und Muße für die beiden Glasfenster mit den Abbildungen der heiligen Elisabeth sowie der heiligen Hedwig von Schlesien und Polen, die ihre Gesichtszüge trägt, hatte? Wir wissen es nicht.
Rudolf Reinhold, der sich als jahrelanges Gemeindemitglied der Pfingstkirche intensiv mit ihrer Geschichte beschäftigt, hat dieser Tage ein Buch über die Glasmalereifenster des sakralen Bauwerkes herausgegeben. Er ging auf Recherche, um Näheres über die gläsernen Kunstwerke mit ihrer farbigen Leuchtkraft in Erfahrung zu bringen, etwa im Archiv der Mayer'schen Hofkunstanstalt GmbH München oder beim Stadtarchiv in Freiburg. Kunsthistoriker gaben ihm wichtige Hinweise.
Die Pfingstkirche wurde im Zuge eines Neubaus (1893) für das Rettungshaus für verwahrloste Knaben, das man bereits 1851 eröffnete, erbaut. Auch ein Pfarr- und Witwenhaus entstanden im Auftrag des Pfingst-Kapellen-Vereins. Die neue Kirche, deren Baumeister Ludwig von Tiedemann war, wurde, wie damals oftmals üblich, im neugotischen Stil erbaut. Die Kaiserin war auch für sie eine leidenschaftliche Anregerin. Überall im Lande, vor allem für Arbeiterviertel der Großstädte, befürwortete sie den Bau von Gotteshäusern. Unterstützt wurde sie von dem Potsdamer Hofbeamten und Spendeneintreiber Ernst von Mirbach. Im Volk erhielt sie schließlich den Spitznamen „Kirchenjuste“. Die Monarchin nahm die Aussage des damaligen Oberhofpredigers Döhring sehr ernst, dass „Katechismus und Kaserne die Grundpfeiler der Sozialisation dieser Zeit“ seien. Und sie selbst war von der Hoffnung überzeugt, wenn nur die Kirche stark genug sei, dann käme alles in die rechte Ordnung. Die Kaiserin als heilige Hedwig, die als Sinnbild für die Ausbreitung und Stärkung der christlichen Kirche in Schlesien und Polen gilt, passt in dieses Bild. Nach dem Tode der Monarchin im Jahre 1921 wurde die Pfingstkirche in Auguste-Victoria-Gedächtnis-Kirche umbenannt. 1946 erhielt sie wieder ihren ursprünglichen Namen zurück.
Die Glasmalereifenster, die auch ein Ergebnis ihrer „Wiederentdeckung“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind, gehören zu den schönsten Kunstwerken der Pfingstkirche. Rudolf Reinhold holt sie mit seinem Text und mit der von ihm verantworteten Buchgestaltung ganz nah heran. Der Autor schreibt Wissenswertes über die Historie der Kirche, ihren Außen- und Innenbau, doch die Glasmalereifenster haben Primat. Er berichtet, dass renommierte Werkstätten mit der Fenstergestaltung beauftragt wurden: die Mayer'sche Königliche Hofkunstanstalt München, das Königliche Institut für Glasmalerei Berlin-Charlottenburg sowie die Firma von Fritz Geiges in Freiburg/Breisgau. Während seines Fenster-Rundgangs macht Reinhold nicht nur auf die Kunst aufmerksam, sondern auch auf die biblischen Vorlagen der Bilder. Das Chorfenster, ein Geschenk Auguste Victorias, erzählt von dem Kinder segnenden Christus. Bekrönt wird es von einer eindrucksvollen Fensterrose. Spannend sind die Aussagen Reinholds über einzelne Figuren, die in der damaligen Zeitgeschichte eine Rolle spielte. Er stellt im Buch den Glasfenster-Porträts zeitgenössische Fotografien gegenüber, auf denen man Züge der Dargestellten vergleichen kann. Die Kaiserin ist nicht nur als Hedwig abgebildet, sondern im Chorfenster als eine schlichte Frau mit einem Kind auf dem Arm. Es soll von Christus gesegnet werden. Auch Ernst von Mirbach und der renommierte Pädagoge Johann Hinrich Wichern sind als Jünger Jesu in das Geschehen integriert.
Bei den Heiligenbildern hat Elisabeth von Thüringen als Sinnbild der tätigen Nächstenliebe Aufnahme gefunden. Die Schwester der Kaiserin, Louise Sophie, gibt ihr ihre Gesichtszüge; der heilige Georg als Sinnbild für den siegreichen Kampf mit dem Unglauben erhielt das Porträt Wilhelms II. Der moderne Gesichtsausdruck des Engels gehört der Tochter Mirbachs, Gabriele. Sie wurde nur ein Jahr und vier Monate alt. Auch Bilderzyklen aus dem Leben Jesu fanden auf Glasfenstern in der Pfingstkirche Aufnahme. Fast kann man das Bild von der Kreuztragung als ein besonderes Bonmot bezeichnen. Ein finster dreinblickender Henkersknecht ist dem Vorsitzenden der Sozialdemokraten, August Bebel, nachgebildet. Er gehörte zu den schärfsten Kritikern des Kirchenbauprogramms der Kaiserin. Immer wieder forderte er die Trennung von Kirche und Staat. So kam mit dem Henkersknecht, wie die Monarchisten Bebel sahen, ein Stück Politik in die Pfingstkirche.
Zum Tag des offenen Denkmals ist die Pfingstkirche am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet
Rudolf Reinhold: Die Glasmalereifenster der Evangelischen Pfingstkirche Potsdam.
Verlag Tredition,
Hamburg 2016.
68 Seiten,
Paperback 22,49 Euro, Hardcover 31,49 Euro
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: