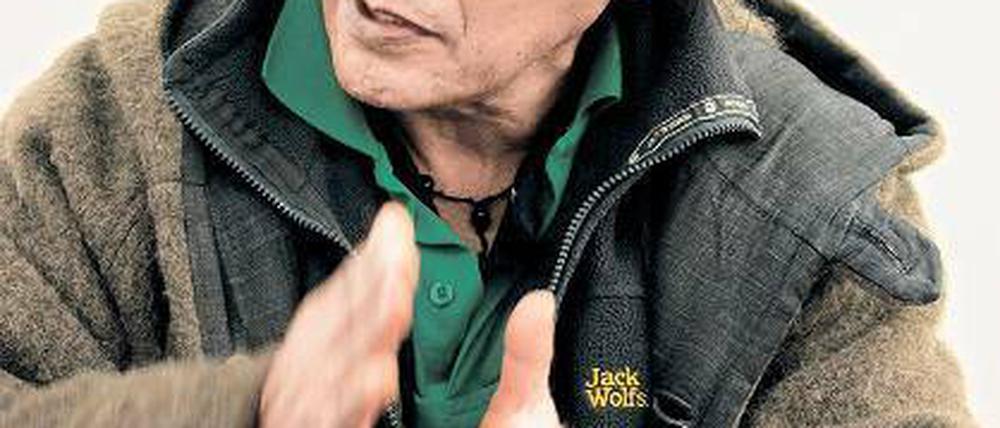
© Manfred Thomas (2)/Johanna Faber
Von Heidi Jäger: Mit dem Feuer als Verbündeten
Amaru Cholango verbrennt für Kunst und greift auf die Weisheit der Schamanen zurück
Stand:
Er hat sein Mobiliar im Feuer geröstet: das Bett, den Kleiderschrank samt Bügel, die vier Stühle. Auch Bücher, Brot und selbst die Gitarre liegen verkohlt auf dem großen Esstisch – der ebenfalls „geschmort“ und von Brandmalen überzogen ist. Das schwarze Mobilar erinnert daran, wie sich in Millionen von Jahren Holz in Kohle verwandelte. Doch die „Mumifizierung“ der Möbel von Amaru Cholango, die wie ein Mahnmal an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern, dauerte nur ein Feuer lang.
Der Künstler aus Ecuador legte selbst Hand dabei an: auf einer Wiese in der Eifel. Er trug bei Regen und Schnee Reisig aus dem Wald zusammen, zündete das feuchte Geäst an und wartete auf die richtige Temperatur der Glut. Doch das allein würde wohl nicht dieses erstaunliche Resultat zur Folge haben, das ab heute in der Ausstellung „Die Zukunft ist keine Zukunft“ im Museum Fluxus+ zu sehen ist.
Amaru Cholango, ein Quechua-Indianer aus den Anden, 59 Jahre alt, machte sich für die Verkohlung seiner Möbel das Feuer zum Freund. „Es hat nicht alles gefressen, sondern mir geholfen, weil wir Respekt voreinander haben“, erzählt der kleine stämmige Mann mit dem wachen Gesicht und den kraftvollen Gesten bei einem Kaffee am Rande der sinnlich vereinnahmenden Feuer-Schau. Der offenherzige Mann ist ein Yachag, ein Weiser, so wie schon sein Großvater und seine Mutter. Ob das Schamanentum in seiner Familie noch weiter, vielleicht bis in die Inkazeit zurückgeht, ist nicht überliefert, sagt er. Allerdings lässt die Endung seines Namens „ango“ auf eine adlige Familie schließen, wie er erst jetzt gelesen hat. Und damit vielleicht auch auf eine wissende. Amaru Cholango ist sowohl in der materiellen als auch in der geistigen Welt zu Hause und versucht, beide zu versöhnen. Ohne Hokuspokus, wie er betont.
Wenn der Mann mit dem schwarzen Zopf und der selbstgemachten Schutzkette aus blankpolierten schwarzen Holzkugeln über „Pacha Mama“ erzählt, scheint die Mutter Erde für einen Moment den Atem anzuhalten. Obwohl es beim Aufbau seiner Ausstellung noch viel zu tun gibt, nimmt sich der unter seiner Hutkrempe verschmitzt lächelnde Künstler die Zeit, genau zu erklären, wie er sich als Schamane das Wissen der Welt aneignet, um vor ihrem Untergang zu mahnen. Schon in den 90-er Jahren, als das Thema Umweltzerstörung noch nicht die Bedeutung hatte wie heute, spürte er sie in seiner Kunst. Er ist tief in der Wissenschaft verwurzelt, doch zugleich ein Sehender des Unsichtbaren. „Die Erde ist nicht nur eine Kugel mit Mineralien, sondern ein Wesen mit Seele und Geist, genau wie ein Mensch, und es braucht viel Respekt, das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren.“ Kunst ist für ihn eine Vorahnung, wie die Hebamme einer neuen Welt.
Schon während der Schwangerschaft spürte seine Mutter, dass Amaru das auserwählte ihrer fünf Kinder sein würde, auf das sie ihr spirituelles Wissen übergehen lassen würde. Und so war sein Kindsein oft auch sehr hart. Mit sieben Jahren musste er allein in die hohen kalten Berge ziehen, um die Natur zu erkennen. Aus Gräsern baute er sich eine Mulde zum Schlafen, musste die Angst vor der Dunkelheit überwinden. Später nahm er sein Pferd mit, wärmte sich an dessen Bauch, wenn er wieder die Nacht in der Höhe zur inneren Einkehr suchte. Das Essen teilte sich das Kind genau ein, lernte aber auch, mit Hunger zu leben. Das gebrannte Brot in der Potsdamer Ausstellung ist für ihn ein wichtiges Symbol. „Wir leben in Sättigung und sind krank vom Essen. Und sehen nicht den anderen Teil der Welt.“ Auch die verkohlten Bücher sprechen von Erfahrungen, vom Umgang mit alten Kulturen. „Wie oft stempelt die vermeintlich hochstehende europäische Kultur andere als primitiv ab?“ Amaru Cholango will Fragen stellen, ohne Antworten zu diktieren.
Der derzeit bei Köln lebende Künstler schaut aber nicht nur auf eine Kindheit der Entbehrungen und inneren Einkehr zurück. Er ist ausgelassen mit seinen Brüdern auf Schweinen geritten, legte übermütig Hühner durch Hypnose schlafen. Wenn er nicht ausmisten, Kühe melken oder den Garten umgraben musste, spielte er mit Erde, baute Skulpturen und Wasserläufe. Durch die Stellung seiner Mutter als Heilerin durfte er schließlich auch zur Schule gehen. Morgens um fünf Uhr machte er sich auf den Weg: drei Stunden hin, drei Stunden zurück, wohlwissend um das Privileg der Anstrengung. Nicht alle seine Brüder und Schwestern hatten die gleiche Chance wie er. Amaru ging auf eine weitergehende Schule und erlebte dort die Härte der Rassendiskriminierung. Als einziger Indianer unter den „Fernandos“, wie er die Nachkommen der spanischen Eroberer nennt, musste er sich auch mit Fäusten zur Wehr setzen.
Mit 14 Jahren wurde er in einer spanischer Familie in Quito untergebracht, um weiter lernen zu können. Er hatte Heimweh, vermisste die Ruhe. Dazu kam seine erste große Krise. Denn auf einmal hieß es, dass nur wahr ist, was fassbar und messbar sei. „Was ich vorher gelernt hatte, sagte mir etwas anderes.“ Er zog in die Berge, um den Widerspruch aufzulösen und seine Gedanken zu beruhigen. Und er nutzte die bildhaften Gleichnisse seiner Mutter, die sich ihm stark eingeprägt hatten. Sie verglich die geistige Welt mit einer Schüssel, in der sich Milch und Käse befinden. „Die Milch ist das Geistige. Der Käse, der aus ihr gemacht wird, die Materie“, sagte sie in ihrer einfachen und schlüssigen Logik. Doch das alte Wissen der Vorfahren kollidierte nun für den in die Welt aufgebrochenen Amaru Cholango mit neuzeitlichen Sichten.
Fast wäre der strebsame kluge Indianerjunge katholischer Priester geworden, hätte er nicht den Termin zur Aufnahmeprüfung verpasst. Für Amaru Cholango war das ein Wink des Schicksals. Er studierte stattdessen Mathematik und Geologie, wurde an der Universität in Quito Dozent. Folgenreich war ein Stipendium in London. Als er in der Nationalgalerie Bilder von Rembrandt und van Gogh sah, wurde alles anders.
„Ich war wie vom Blitz getroffen und wusste, nur die Kunst ist mein Weg.“ Um offensichtlich lange Angestautes freizulassen, zeichnete er wie besessen Kirchen, machte Farbstudien – war aber nicht zufrieden mit der Ausbildung an der Londoner Kunstakademie. Er ging nach Paris. Auch dort fand er nicht, was er suchte. Erst an der Europäischen Akademie in Trier, wo er als Zeichenlehrer zum „profiliertesten Dozenten sowie wichtigen Anreger für eine stärkere avantgardistische Orientierung der Akademie“ wurde, wie ihm Kunstkritiker sagten, waren für ihn die Weichen richtig gestellt. Dennoch schlug er einen kurvenreichen Weg ein, was seine erste Skulptur zeigt, die er mit nach Potsdam brachte. Sie ist weich und schmiegt sich sanft an die Hand, ist ohne Anfang, ohne Ende. Der weiße Gips ist blankgeputzt und hat nichts von der Brüchigkeit des schwarzen verwundeten Holzes.
Amaru Cholangos Mutter wusste nicht, was Kunst ist. Aber sie ließ den Sohn langsam los, so dass er seinen eigenen Geist fließen lassen konnte. Erst als sie 2001 starb, sprach er öffentlich über seine schamanische Erziehung. „Ich wollte nicht in eine Schublade mit der Aufschrift Esoterik gesteckt werden. Die Kunstwerke sind das Entscheidende.“ Und die wussten sich auch ohne Erklärung in der zeitgenössischen Kunst zu behaupten und wurde bereits weltweit gezeigt: im Tacheles Berlin ebenso wie in Rom. Und nächstes Jahr in einer großen Schau in Quito.
Der redselige Bildhauer findet durch höchste Konzentration, ohne Drogen, wie er betont, in eine andere Sphäre und wird dabei zum Traumfänger. So wie er das Feuer fängt. Es ist wie ein Gebet, wenn er sich mit einem Element verbindet und unsichtbare Geschichten der Nacht auch in der Kunst sichtbar werden lässt.
Es macht ihn froh und traurig zugleich, sein Bett jetzt verkohlt vor sich zu sehen. „Es ist geprägt durch mein Wesen. Es so vor mir zu haben ist wie eine Trennung. Wir sind nicht mehr intim. Dafür sehe ich den Reiz des Materials.“ Und dahinter die große Frage: Sind wir Parasiten und zerstören unsere Erde? Der weitgereiste Künstler ist kein Nihilist, eher ein Provokateur, der mit den Füßen auf der Erde steht und den Geist fliegen lässt.
Bei einem Ritual im T-Werk, das heute der Ausstellungseröffnung im Fluxus-Museum voraus geht, wird er erneut das Feuer beschwören und auch die nackten Füße der Gäste berühren, um sie zu reinigen. „Es könnte dabei zu einer Veränderung in ihrem Denken kommen“, prophezeit Amaru Cholango. „Als Wissenschaftler forsche ich jeden Tag an der Welt, und was ich nicht mit Worten sagen kann, sage ich über meine Kunst.“ Derzeit mit dem Feuer als Verbündeten. Nur einen Nachfolger hat er noch nicht gefunden, auf den er sein Wissen als Schamane übertragen kann. Aber auch da vertraut er auf das Schicksal.
Zur Ausstellung heute um 19 Uhr gibt es im T-Werk die Performance von Amaru Cholango „Quo vadis? – Wohin gehst du?“ und anschließend die Eröffnung im Fluxus-Museum im Schirrhof der Schiffbauergasse
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: