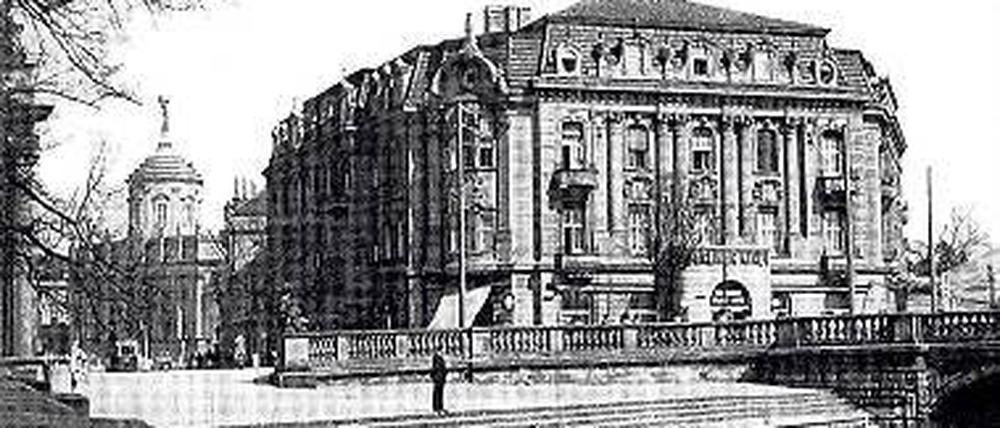
© Archiv
Kultur unterm Hakenkreuz: Potsdam leuchtete in vielen Farben
Bei den rechtskonservativen Potsdamern waren die Autoren, die sie verkauften und verlegten, nicht beliebt. Der Buchhändler und Autor Karl Heidkamp sowie sein Freund, der Verleger Alfred Protte, ließen sich davon lange nicht einschüchtern. Unter den Nazis aber mussten auch sie sich anpassen.
Stand:
Nicht alle Einwohner waren glücklich über das Sortiment. Die Buch- und Kunsthandlung von Karl Heidkamp, gegenüber vom Potsdamer Stadtschloss, im renommierten Palasthotel führte in den 1920er-Jahren Autoren wie Erich Maria Remarque, Romain Rolland, Leonhard Frank oder Rosa Luxemburg. Autoren also, die Krieg und Gewaltherrschaft ablehnten, sozialistische Ideen bevorzugten. Das wurde von erzkonservativen und rechts gerichteten Potsdamern abgelehnt.
Als Karl Heidkamp dem Roman „Pierre und Luce“ des französischen Dichters Romain Rolland mit Illustrationen des linken Grafikers Frans Masareel ein Sonderschaufenster widmen wollte, musste er die Polizei um Hilfe rufen, um „eine Demolierung des Geschäftes durch eine Bande von verhetzten Jugendlichen und auch älteren Mitläufern zu verhindern.“ Im Jahre 1931 schließlich schloss Karl Heidkamp seine Buch- und Kunsthandlung. Im konservativen Potsdam hatte die Literatur, die er verkaufen wollte, einen schweren Stand. Zwei Jahre später wurden die Bücher jüdischer, marxistischer, pazifistischer und anderer oppositioneller oder politisch unliebsamer Schriftsteller von den Nationalsozialisten verbrannt.
Der gebürtige Potsdamer Karl Heidkamp, geboren 1896, gestorben 1970, verdiente sein Brot von nun an als Schriftsteller. Für den Rundfunk, die Fach- und Tagespresse schrieb er Texte zu Kunst und Geschichte. Auch seine Vorträge zu diesen Themen an der Volkshochschule waren gut besucht. Bei dem befreundeten Verleger Alfred Protte veröffentlichte Heidkamp 1933 das Buch „Symbol und Allegorie - Potsdam“. Dieses Thema, das vor allem die Preußenkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. ins Visier nahm, hätte dem Autor im Jahr des „Tags von Potsdam“, der von den Nazis in und an der Garnisonkirche – der Grablege der Monarchen – inszeniert wurde, staatlicherseits viel Ruhm einbringen können.
Doch Karl Heidkamp hielt nichts von verordneter Einheits-Meinung. Für ihn hatte der Geist von Potsdam mit der Toleranz des Großen Kurfürsten, der Rechtlichkeit Friedrich Wilhelms I. und der Aufklärung Friedrichs des Großen zu tun, wie der Historiker Günter Wirth feststellte.
Von all dem war im nationalsozialistischen Deutschland nichts zu spüren. Der Schriftsteller Eugen Diesel, der im Herrenhaus des Kronguts Bornstedt wohnte, schrieb im Vorwort zu „Symbol und Allegorie“: „Wir erkennen () deutlich, dass Potsdam nicht etwa ein absoluter Ausdruck des militärischen Preußengeistes ist (); vielmehr leuchtet Potsdamer Wesen in sehr vielen Farben, zeigt sich in den mannigfaltigen Perspektiven...“. Und weiter schrieb er, dass Potsdam lebendig sei „durch seine Geschichte, aber es ist nicht nur historisch, sondern es ist immer noch aus sich selbst heraus lebendig.“
1935 wandte sich Karl Heidkamp in einer Publikation nochmals dem Soldatenkönig zu. „Friedrich Wilhelm I. - ein deutsches Vorbild“ erschien im Athenaion Verlag Potsdam, in dem er als Lektor für kurze Zeit tätig war. Er wurde entlassen, nachdem ihm das Kampf- und Werbeblatt der SS „Das schwarze Korps“ angriff. Ab 1935 durften Karl Heidkamps Bücher nicht mehr verkauft werden.
Heidkamp reagierte auf die Wechsel der Zeiten sensibel, manchmal unentschlossen. In seinen Erinnerungen schrieb er: „Merkwürdige Wege geht der Mensch, der keinen Kompass hat.“ Bei scharfer Ablehnung des Nationalsozialismus bildete sich bei ihm ein Konglomerat von Weltanschauungen. Darin war er nicht allein.
Neben Karl Heidkamp nahm auch der Verleger Alfred Protte Einfluss auf das geistig-kulturelle Leben Potsdams. Publikationen von Autoren aus dem liberalen Bürgertum standen auf dem Verlagsprogramm Prottes. Vor allem waren es sozialkritische und ökonomische Themen, die den Verleger interessierten. Der Verlag verstand sich auch als ein Forum linker deutscher Intellektueller, die nach gesellschaftlicher Neuordnung – nach sozialistischer Gestaltung strebten, Autoren, die der Sozialdemokratie nahestanden.
Konnten in den ersten Monaten des Jahres 1933 noch Bücher des Theologen und Religionsphilosophen Paul Tillich, des jüdischen Arztes und Soziologen Franz Oppenheimer oder des Journalisten Rudolf Küstermeier, der die Widerstandsgruppe „Roter Stoßtrupp“ gründete, erscheinen, so war danach in den Verlags-Publikationen „eine verhaltene Anpassung an die Verhältnisse in Nazideutschland zu verzeichnen, in denen das Nationale (wenn nicht das Völkische) und das Militärische in besonderer Weise akzentuiert wurden.“ Die Zensoren lagen ständig auf der Lauer. Auch im Verlagswesen machte sich die Gleichschaltung der Literatur breit.
Als 1935 Heinrich von Kleists politische und journalistische Schriften bei Protte erstaunlicherweise erscheinen konnten, schrieb der Verleger dem Herausgeber Adam von Trott zu Solz: „Es wird Sie () interessieren, dass das Buch gleichfalls vor einigen Tagen von dem Beauftragten für die ges. geistige und weltanschauliche Erziehung in der NSDAP Abtlg. Schrifttumspflege zur Prüfung angefordert wurde.“
Adam von Trott, der zu den Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 gehörte und der nach dem Scheitern des Attentas auf Hitler zum Tode verurteilt wurde, schrieb in der Einleitung zum Kleist-Buch mit Blick auf den Rebellen Michael Kohlhaas, dass der „Kern aller politischen Existenz“ die Möglichkeit der freien Gewissensentscheidung sei – vor allem gegen eine Politik, die die echte menschliche Ordnung zu gefährden vermag. Weiter heißt es: „Je unsicherer es mit der Welt überhaupt bestellt ist, desto sicherer ist es notwendig, für dieses Recht zu kämpfen.“ Bis 1939 hat der 1902 in Bonn geborene und in Potsdam aufgewachsene Alfred Protte mit seinem Verlag durchgehalten.
Alfred Protte und Karl Heidkamp mussten als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ziehen und gerieten anschließend in Kriegsgefangenschaft. Heidkamp war danach ab 1949 als Lektor in verschiedenen Verlagen und beim Verband Bildender Künstler der DDR tätig. Protte arbeitete ab 1951 im Akademie-Verlag Berlin und baute anschließend das Zeitungsausschnittsarchiv zur Brandenburger Geschichte im Bezirksheimatmuseum Potsdam auf. Klaus Büstrin
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: