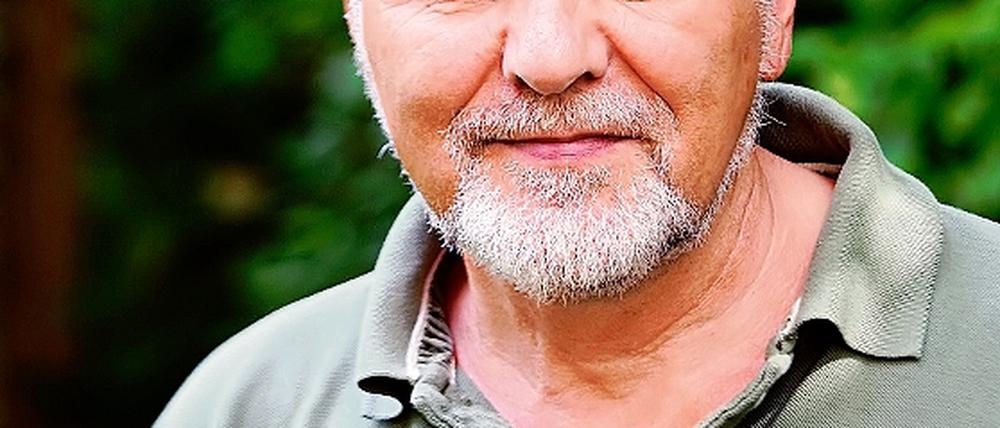
© Manfred Thomas
Von Heidi Jäger: Zwischen Euphorie und Ernüchterung
Michael Philipps war 40 Jahre Dramaturg am HOT und erlebte sieben Intendanten / Jetzt hat er seinen eigenen Spielplan
Stand:
Theaterstücke nimmt er vorläufig nicht mehr zur Hand. Durch Hunderte von Textbüchern las er sich während seiner 40 Jahre am Hans Otto Theater, immer auf der Suche nach dem großen Stoff, der Herz und Hirn entzündet. Wenn sich Michael Philipps heute auf seiner sonnigen Gartenbank in Babelsberg zurücklehnt und sieben Intendanzen Revue passieren lässt, schwankt er zwischen Euphorie und Ernüchterung. Während er zu den frisch geernteten Aprikosen aus Nachbars Garten greift, erzählt er, wie er den großen Theaterprinzipal Gerhard Meyer kennenlernte, der morgens durchs ganze Haus in der Zimmerstraße ging und jeden Mitarbeiter namentlich begrüßte. Damals war Michael Philipps im ersten Studienjahr und lernte erst einmal die Praxis kennen. Er roch in alle Gewerke hinein und durfte auch schon mal mit dem Scheinwerfer Figaro verfolgen. Eine Nähe zu den Kollegen hinter der Bühne, die ihm später auch am Dramaturgen-Schreibtisch zugute kam.
Doch bevor er in Potsdam auf Dauer Fuß fasste, ging er den Umweg über Meiningen. Für 450 Mark war er das „Mädchen für alles“, führte Regie, gab den Statisten, suchte nach den richtigen Stücken. „Es war ein harter Vertrag, aber da Meiningen ohnehin hinterm Berg lag, die Stadt nur vom Theater lebte und ich noch keine Familie hatte, versäumte ich ja nichts.“
Drei Jahre später wurde die ersehnte Stelle in der Heimatstadt frei, unter Peter Kupke, der vor allem auf neue Dramatik setzte und sich auch vor Bruchlandungen nicht fürchtete. Es war die Hohezeit von Brecht und Brecht-Mimin Carmen-Maja Antoni. Mit Intendant Gero Hammer begann 1970 die für Philipps interessanteste und politisch angespannteste Zeit. „Wir spürten, dass Theater eine Funktion hat: nämlich subversiv zu sein und wider den Stachel zu löcken.“ Wenn er sich durch neue Stücke las und Proben begleitete, hatte er nie die innere Schere im Kopf, er versuchte vielmehr, die Karten voll auszureizen und nicht zu Kreuze zu kriechen. „Die Preußen kommen“ lief 220 Mal über die Bühne, ganz Potsdam sah dieses Hamel-Stück, das er gemeinsam mit Regisseur Eckhard Becker durch eine gelungene Strichfassung politisch brisant aufmöbelte. Das Stück wurde aus der Beliebigkeit herausgeholt, auch dank des im Juli in den Ruhestand verabschiedeten Dramaturgen.
In Gero Hammer hatten die Theatermacher die notwendige Rückendeckung. „Er war ein guter Außenpolitiker, wagte viel und spielte mit den Oberen gern Katz und Maus.“ Autoren wie Heiner Müller, Volker Braun, Fugard oder Lorca – alles fand auf der kleinen provisorischen Bühne des ehemaligen Tanzlokals statt. Trotz Hinterhofdasein spielte das Potsdamer Theater in der ersten Reihe mit. Es galt als Sprungbrett für Berlin und namhafte Schauspieler wie Jutta Wachowiak, Winfried Glatzeder oder Thomas Langhoff lernten hier das Laufen. Bis heute steht das Hans Otto Theater auch in dem Ruf, dass es schwierig zu führen ist. Michael Philipps kennt das Künstlervölkchen mit seinen Eitelkeiten und Egomanien. In Potsdam war es eine besondere Gratwanderung, denn man wollte selbstbewusst aus dem Schatten Berlins heraustreten. Immer mit starken Schauspielerpersönlichkeiten, die etliche Regisseure aushebelten. Er selbst versuchte, in seiner ruhigen, ausgleichenden Art zu vermitteln. Aber oft mussten am Ende die Intendanten die Feuerwehr spielen.
Schon vor 1989 gab es die Angst, dass Stücke kein Publikum finden, aber sie wurden dennoch gemacht. Regisseure wie Peter Brähmig, Günter Rüger oder Rolf Winkelgrund setzten dabei Maßstäbe. Winkelgrunds „Weißer Anzug“ war 1983 ein Meilenstein. Er erzählte in Form einer Parabel, wie die sozialistische Revolution pervertierte.
Verbote hat es nie gegeben, „der Einfluss war viel subtiler“, so Michael Philipps, der hellwach nach immer neuen theatralischen Reizen suchte. „Man konnte sich nicht allem entziehen, aber wir machten auch keine Agitation und Propaganda.“ Gerade Gero Hammer sei so versiert gewesen, dass er abschätzen konnte, was geht und was nicht. Ein Stück wie „Jochen Schanotta“ von Jürgen Seidel über einen jugendlichen Totalverweigerer in der DDR wurde von den Partei-Behörden als sozialismusfeindlich eingestuft und Hammer ließ dann auch die Finger davon. Michael Philipps hat es trotzdem in seinem Arbeitertheater in Teltow, das er 25 Jahre leitete, auf die Bühne gebracht und Sätze wie „Die DDR ist von einem Stacheldraht umwickelt“ fanden hier ungestraft Gehör.
In der Zeit der Perestroika setzte die künstlerische Leitung vor allem auf sowjetische Stücke, wie „Zeit der Wölfe“ oder „Morgen war Krieg“, in denen es um Stalinismus und Umweltsünden ging. Sie legten die Finger auf die Wunde. Die Zuschauer rannten ins Theater und anschließende Gespräche waren wie Türöffner, um politischen Unmut abzuladen. Bei „Revisor oder Katze aus dem Sack“, einer Adaption von Jürgen Gross auf die Gogolsche Komödie ging es den Genossen dann doch zu weit. Es war ein höchst angespannte Zeit, Wahlfälschungen, Botschaftsbesetzungen, die Flucht über Ungarn in den Westen. Dieses Stück, von Michael Philipps dramaturgisch betreut, benannte Ross und Reiter, zeigte, wie Spitzenfunktionäre ihre Leichen im Keller vertuschen. „Die Satire wurde 1:1 genommen und viele sahen sich wohl vorgeführt. Günther Jahn, der oberste Bezirksparteichef, trat nach der Premiere eine regelrechte Hexenjagd auf das Theater los. Er warf uns vor, dass im Theater die Konterrevolution marschiert.“ Aber auch da gab es kein offizielles Verbot, das Stück wurde vielmehr „ausgesetzt“. „Und wenn die Wende nicht gekommen wäre, hätte man Gero Hammer sicher abgesetzt.“
Nach 1989 kamen dann andere Aufregungen: neue Sprachregelungen, neue Schauspieler, neue Regisseure aus den alten Bundesländern. „Wir erlebten einen regelrechten Kulturschock und auch den freien Fall, denn plötzlich konnte jeder gekündigt werden.“ Die Zeiten, dass man als Dramaturg von der ersten Probe bis zur Premiere eine Inszenierung begleiten konnte, waren für Michael Philipps so gut wie vorbei. Oft fühlte er sich als fünftes Rad am Wagen. „Heute werden Regisseure meist nur eingeflogen und bringen ihre fertigen Konzeptionen mit. Dadurch geht viel vom Beruf des Dramaturgen verloren, er wird zum Materialbeschaffer, Programmheftschreiber, Produktionsleiter degradiert.“ Nach der Wende konnten die Theater nun zwar alles spielen, auch Becketts „Warten auf Godot“, aber es war kein Thema mehr für die Zuschauer, die sich in einer Gesellschaft zwischen Reisefreiheit und Arbeitslosigkeit orientieren mussten. Der erste Nachwende-Intendant Stephan Märki habe das Publikum zudem oft überfordert, „er wollte das 13. Berliner Theater sein. Auch fehlte ihm jeder Draht zu den Behörden“, erinnert sich Michael Philipps. Nachfolger Guido Huonder sei wiederum ein Anarchist im besten Sinne gewesen, aber mit seiner jüdischen Dramatik inszenierte auch er ans Publikum vorbei. „Er war der, der uns das Blechzelt angeschleppt hat und zugleich der Visionär, der den Standort Schiffbauergasse für das Theater entdeckte.“
Ralf-Günter Krolkiewicz hat schließlich versucht, die Situation zu stabilisieren und auch mit populistischen Angeboten die Zuschauer zu fangen. Auch das hat nicht geklappt. „Erst mit Uwe Eric Laufenberg kam frischer Wind, er hat uns gerettet und das Theater wieder ins Gespräch gebracht.“
Zudem entsprach er wieder mehr dem Potsdamer Stil, der über Jahrzehnte das Hans Otto Theater prägte: Geschichten zu erzählen mit einem realistischen Duktus, statt sich selbst in Szene zu setzen und nur aufs Feuilleton zu schielen.
Durch Laufenberg fand Michael Philipps zu einem versöhnlichen Abschluss, auch weil junge Regisseure wie Tobias Rott, Carsten Kochan und Sebastian Wirnitzer wieder seinen Rat suchten. Auf die nächste Truppe ist der „Dienstälteste“ nun nicht mehr neugierig. Es gibt andere Felder zu beackern. Statt Theaterstücke liest er jetzt Biografien und Historisches. Und er recherchiert auch selbst zu einer Persönlichkeit, die Opfer der Geschichte wurde. Nur einen Steinwurf von seinem Haus entfernt wurde der jüdische Regisseur und Schauspieler Kurt Geron, bekannt als Puff-Chef im „Blauen Engel“, von Goebbels 1933 persönlich des Babelsberger Drehorts verwiesen. Später depotierte man ihn nach Theresienstadt, wo er einen Propagandafilm für die Nazis drehen musste: über das angeblich so menschenfreundliche Lagerleben. Als der Film im Kasten war, wurden alle Beteiligten in den nächsten Zug nach Auschwitz und damit in den Tod geschickt.
Michael Philipps brennt für diesen Stoff und hofft, dass daraus ein Spielfilm wird. Mit einem Regisseur, dem er vertraut. Er selbst möchte dabei wie immer in der zweiten Reihe bleiben.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: