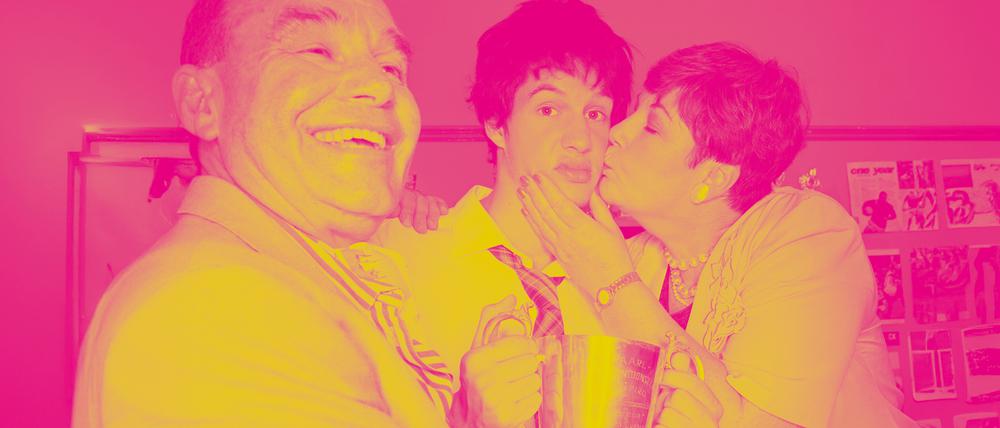
© Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss/Foto: Getty Images, The Image Bank, Karan Kapoor
Mehr als Blutverwandtschaft: Eine Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum definiert Familie neu
Bei manchen gehört die langjährige Nachbarin dazu, ein alter Freund oder ein Haustier: In der Ausstellung „Beziehungsweise Familie“ ergründet das Museum Formen und Traditionen des Zusammenlebens.
Stand:
Manchmal ist Familie mehr als Blutverwandtschaft. Dann gehört vielleicht auch die langjährige Nachbarin dazu, ein alter Freund, der immer weit präsenter war als ein abwesender Vater. Oder ein längst verstorbenes Haustier, über das man sich immer noch Geschichten erzählt. Was Familie alles sein kann, darum geht es in der neuen Ausstellung „Beziehungsweise Familie“ im Humboldt Forum.
Im Erdgeschoss können die Besucher:innen zunächst in einem neu gestalteten Raum an zehn Stationen selbst aktiv werden. Bei einer Art Familienaufstellung kann jeder seine eigene Familie anhand von beschrifteten Kugeln auf ein Raster legen. Auf den bunten Bällen, die zur Auswahl stehen, sind nicht nur Begriffe für „Mutter“ oder „Vater“ zu finden, sondern auch für Freunde, Mentoren, geistige Wesen, Tiere, Pflanzen oder andere wichtige Bezugspersonen.
Auf Knopfdruck machen die Besucher:innen von ihrer persönlichen Anordnung ein Foto, das kurz projiziert und dann archiviert wird. „Es wird ein reicher Schatz für uns sein, hier die immense Diversität von Familienstrukturen zu sehen, die weit über das Konzept der Kernfamilie hinausgehen“, sagt Laura Goldenbaum, eine der Kuratorinnen.
Jenseits des Einfamilien-Hauses
Für die Ausstellung haben zum ersten Mal alle im Berliner Schloss ansässigen Akteure zusammengearbeitet: die Stiftung Humboldt Forum, das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst, das Stadtmuseum Berlin. Auch die Humboldt-Universität war beteiligt. „Wir sind gemeinsam durch das ganze Haus gegangen, um zu schauen, wo das Thema Familie überall drin steckt und wie sich Verbindungen herstellen lassen“, sagt Goldenbaum.
In einer anderen Ecke kann man sich virtuell an den Essenstisch verschiedener Familien in Berlin setzen. Mithilfe einer VR-Brille lässt sich dort Platz nehmen und den Gesprächen lauschen. An einem Rondell machen zwölf Modelle von Wohnformen anschaulich: Nicht überall auf der Welt leben Familien so stark voneinander abgegrenzt wie in westlichen Kulturen.
Im nordamerikanischen Langhaus etwa wohnen mehrere Familien zusammen neben ihren Werkstätten und Lagerräumen. Das Rundhaus aus Amazonien bietet sogar Platz für 50 bis 200 Menschen. Jede Familie hat ihr Kompartiment, die Mitte dient als Dorfplatz. An anderer Stelle geht es um die Situation von Berliner Pflegekräften, die auf großen Bildschirmen von ihrer Arbeit erzählen. Während sie sich in Deutschland um die Angehörigen von anderen kümmern, sind sie von ihren eigenen Familien oft über Kontinente hinweg getrennt.
Neben der Sonderfläche im Erdgeschoss gibt es weitere 40 ausgewählte Objekte zum Thema Familie, die in den Dauerausstellungen im gesamten Gebäude zu finden sind. Sie zeigen, wie Machtverhältnisse familiäre Biografien prägen oder erzählen persönliche Familiengeschichten aus aller Welt und zu verschiedenen Zeiten.
Andere Kulturen zählen auch die Geister der Ahnen dazu
In der zweiten Etage geht es zum Beispiel um die Gesellschaften am Sepik-Fluss in Papua-Neuguinea, in denen die toten Familienmitglieder so präsent sind wie die lebenden. Die zu Ahnen gewordenen Verstorbenen können sich in verschiedenen Formen zeigen – etwa als Krokodile. Sie wachen weiterhin über ihre Familie und schützen sie, können sie aber auch bestrafen. Die Yoruba in Nigeria verehren Zwillinge auf besondere Weise. Verstirbt ein Zwilling, ersetzen sie ihn durch eine hölzerne Figur und pflegen ihn weiter.

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss/Gestaltung: Studio Fasson Freddy Fuss/Fotografie: Deepak Tolange/Foto: Frank Sperling
In einem Hör-Raum erklingen Schlaflieder aus der ganzen Welt, die keineswegs immer leise und sanft sind. „Es gibt auch laute Wiegenlieder, bei denen es die Eltern mit dem Lärm des Regenwalds aufnehmen müssen und sich auf raffinierte Weise mit dem komplexen Klanggeflecht des Waldes verbinden“, berichtet Maurice Mengel, Medienforscher am Berliner Ethnologischen Museum.
An einer weiteren Station geht es um Sprache. Immer weniger Kinder auf der Welt lernen die Sprache ihrer Vorfahren, sodass auch die Weitergabe von Familienwissen innerhalb der Generationen unterbrochen wird. In Videos auf großen Bildschirmen erzählen Menschen, die eine vom Aussterben bedrohte Sprachen sprechen, von ihren Familientraditionen.
Viele der Objekte sind auch für Kinder interessant. Eine Rallye für Familien lädt dazu ein, mithilfe eines Mitmachheftes die Ausstellung zu erkunden – in dem Heft befinden sich Aufgaben, kleine Überraschungen und Geschichten für jede Station. Das hilft vielleicht auch dabei, sich auf der Suche nach den Stationen nicht von den langen Strecken im riesigen Schlossgebäude frustrieren zu lassen. Ein Leitsystem am Boden und farbige Figurinen, die auf das Familien-Thema hinweisen, sollen die Suche erleichtern.
Die Ausstellung ist Teil eines Themenjahres, zu dem auch Lesungen, Workshops oder Performances gehören. Eine Ringvorlesung der HU mit Forschenden aus dem In- und Ausland ist bereits im Wintersemester 2024 gestartet und wird bis zum Sommersemester 2026 laufen. Beteiligt waren auch Studierende der HU, die an Seminaren zur Theorie und Praxis des Kuratierens teilgenommen haben. „Für uns ist diese Ausstellung ein toller Ort, um Lehre, Forschung, Gesellschaft und Kultur miteinander in Beziehung zu setzen“, sagt Claudia Mareis, Kulturwissenschaftlerin an der HU.
Zudem gibt es Stationen außerhalb des Schlosses. Die Eintrittskarte gilt auch für das etwa 500 Meter weiter gelegene Knoblauchhaus, das zum Stadtmuseum gehört. Hier wird in originalgetreu eingerichteten Zimmern die Geschichte der Berliner Kaufmannsfamilie Knoblauch erzählt, die dort vor etwa 200 Jahren lebte.
Zu erfahren ist zum Beispiel, dass die Töchter gemeinsam mit anderen jungen Frauen eine Art „Girls Club“ gründeten, um sich die Zeit bis zur Heirat angenehmer zu gestalten. Der Begriff „Wartefräulein“, den man damals für unverheiratete Frauen wie sie nutzte, drückt aus, wie eintönig das sonst gewesen sein muss. Zudem haben 30 Berliner Kita-Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren das historische Wohnhaus der Familie Knoblauch erkundet und sich gemeinsam mit der Künstlerin Anna Heidenhain damit beschäftigt, wie Kinder damals lebten. Die Ergebnisse sind im ersten Stock zu sehen.
- Berliner Schloss - Humboldt Forum
- Familie
- Hochschulen
- Kunst in Berlin
- Lehrer
- Pflanzen
- Tiere
- Wohnen in Berlin
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: