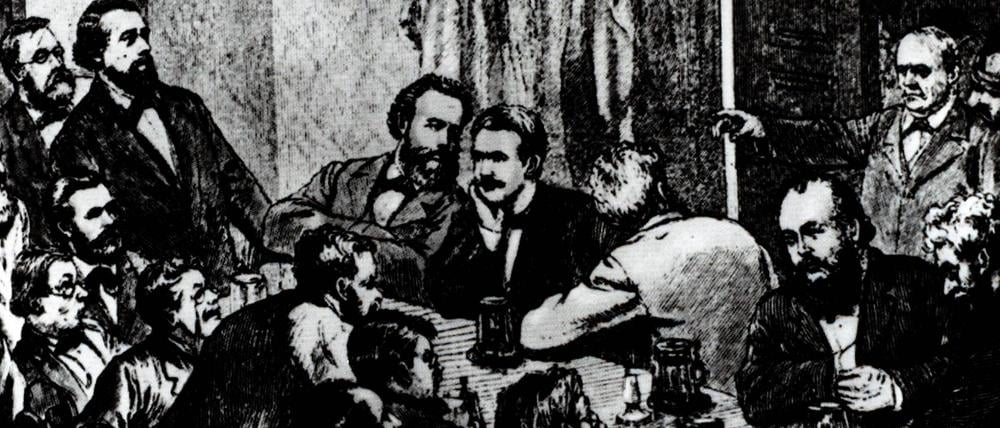
© imago images / United Archives International/imago stock&people
„Physiognomie der Parteien“: Tagesspiegel-Leitartikel vom 20. November 1945
Zeitungsgründer Erik Reger rechnete zunächst noch mit einem Zusammengehen von SPD und KPD in Berlin und sah dies als sinnvoll an, mit Blick auf ein kommendes Zweiparteiensystem.
Stand:
„Ich komme mir vor wie ein altes, gutes, deutsches Gewissen“, sagte der greise Arndt, „mit dem von Gesundheit blühenden Gesicht unter den schneeweißen Haaren“, als er auf der Rednertribüne der Paulskirche stand. Wie mancher kam sich seitdem so vor, aber die Frage, was das „alte, gute, deutsche Gewissen“ eigentlich sei, blieb unentschieden. Trotzdem werden wir es niemandem abstreiten, der andere Auffassungen hat als wir — auch dann nicht, wenn man uns gegenüber nicht so verfährt. Der „Tagesspiegel“ ist weder ein Parteiblatt noch ein Organ der Parteifeinde. Die Bedeutung der Parteien liegt darin, daß sie berufen sind, den politischen Willen eines Volkes zugleich auszudrücken und zu formen. Sie tragen die Verantwortung dafür, daß im Sturm der zeitlichen Gegensätze das Samenkorn der Zukunft befruchtet wird. Sie haben die Pflicht, ihre Ideen an der Problematik der Staatsgewalt zu erhärten oder ohne Substanzverlust abzuwandeln. Wenn sie diesen drei Aufgaben nicht gewachsen sind, stiften sie Schaden statt Nutzen. Ueberflüssig werden sie nie, weil sie unter allen Umständen ein unentbehrliches Instrument der Politik bleiben.
Wenn man jedoch den Parteien dies zugesteht, muß man auch den Parteilosen zugestehen, daß sie als Partei bewertet werden. Sie setzen sich ja nicht nur aus unverbesserlichen Spießern und Ueberindividualisten zusammen, und selbst wenn es so wäre, prägte sich darin ein Teil des politischen Charakters des ganzen Volkes aus. Eine Partei ist gut, wenn sie die Erziehung des Volkes zur Souveränität der Nation begünstigt. Eine Partei ist schlecht, wenn sie selbst sich gegen die Erziehung durch die Ereignisse sträubt oder diesen Vorgang mit Opportunismus verwechselt. In der hundertzwanzigsten Nummer seines „Rheinischen Merkur“, den die Franzosen die „cinquieme puissance“, Europas „fünfte Großmacht“, nannten, schrieb Joseph Görres: „Nur von innen heraus muß die Besserung gehen, nicht Menschen und Partei, nein, die Grundsätze muß man unerbittlich und streng verfolgen.“ Es stimmt insofern nicht, als die Politik gerade bestrebt sein muß, die Kräfte Grundsatz, Mensch, Partei aus der Sphäre der Widersprüche in die der Uebereinstimmung zu heben.
Wir Deutschen haben eine kurze politische Geschichte, und es wäre wohl einer Untersuchung wert, warum das stärkste Parteileben sich zwischen 1880 und 1900 entfaltete, mit einem letzten Aufflackern zwischen 1908 und 1914, und warum das Parteiwesen zu einer grotesken Posse wurde, als1 ihm mit der Weimarer Republik die größten Freiheiten zugefallen waren. Als die Sozialdemokraten ein Bebel führte, die Nationalliberalen ein Bennigsen , die Freisinnigen ein Eugen Richter, das Zentrum ein Windthorst, die Konservativen ein Kardorff, schien das Parlament vorübergehend eine Schule des Parlamentarismus zu werden. Die Krügerdepesche, das Daily-Telegraph-Interview, der Fall Zabern waren für die in den Parteien verkörperte Macht der Volksmeinung ebenso viele Anlässe, sich mitreißend und mitgerissen zu entzünden, waren ebenso viele Momente der Hoffnung auf Demokratisierung und evolutionären Fortschritts in Deutschland. Prüft man die Wahlbeteiligung jener Zeit, so entdeckt man nur in Preußen, dem Staate des Dreiklassenwahlrechts, ein Heer von Parteilosen. Die Zabernaffäre füllte das Jahr 1913. Wäre darauf nicht der Krieg gekommen, so hätte die deutsche innere Geschichte vielleicht eine glückliche Wendung genommen.
Es scheint ein historisches Gesetz zu sein, daß die großen Briganten, die Welten in Blut und Tränen erschüttern, am Ende lautlos verschwinden. Auch der wildeste Spuk muß verfliegen, eben weil er ein Spuk ist. Mussolini, Hitler, Himmler, sie alle versanken wie der Geist von Hamlets Vater, in Nacht und Nebel. Es regnete zwar Feuer und Schwefel, doch die Welt krachte nicht zusammen, kein Donnergetöse entstand, in Deutschland merkten die Leute nicht einmal, daß sie ihres „Führers“ ledig geworden waren. Sie vermißten ihn weder, noch atmeten sie auf; sie wußten ganz einfach nichts. Was mit der Niederlage über sie hinstürzte, war so apokalyptisch, daß es ihnen außer der Rede das Gefühl verschlug. Urplötzlich sollten sie eine Meinung äußern dürfen; aber sie hatten keine Meinung. War 1918 viel echte revolutionäre Leidenschaft vertan, mißbraucht, enttäuscht worden, so zeigte sich diesmal auf den verhärmten Gesichtern weder die Röte der Begeisterung noch die Blässe des Zornes. Strömten 1918 die Soldaten ins Land zurück, so strömten sie 1945 aus dem Lande hinaus, in die Gefangenenlager. Zehn Millionen Männer fehlen. Zehn Millionen, die dem politischen Leben überhaupt erst seine Legitimation geben.
Dies war die Situation, in der einen Monat nach Schluß des Krieges in der russischen Zone die Gründung von Parteien erlaubt wurde. Sie war sehr schwierig; man kann gerechterweise das, was geschah, nicht kritisieren. Man kann es auch nicht billigen; man kann es nur feststellen. Es versammelten sich also in Berlin die Träger von Namen, bei deren Klang man aufhorchte, weil man wußte, daß man sie schon gehört hatte, und sich besinnen mußte, wo; es versammelten sich die „Uebriggebliebenen“, erfreut, daß ihrer soviele waren, und präsentierten sich dem Volke als neue Parteivorstände. Man zählte ab und machte in vier Gruppen rechts und links schwenkt marsch; dann wieder gab man das Kommando, zu einer Kompaniefront aufzuschließen. Man sandte vier Programme aus, und die Leute lasen es wie eines; man einigte sich auf ein Programm, und die Leute fragten: Wozu dann vier Parteien? Die Worte, die an ihr Ohr klangen, glichen den Worten von 1918: Wiederaufbau, Opferbereitschaft, auf zur Tat! Von Wilhelm II. über Bauer, Stresemann, Brüning zu Hitler hatte nie jemand etwas anderes verlangt. Statt „Auf zur Tat!“ hieß es bei den Aktivisten vergangener Zeit: „Arbeiter, heraus auf die Straßel“ Damals war das Ziel die proletarische Diktatur. Eine Verheißung für die eine, ein Schreckgespenst für die andere Seite. Inzwischen hatte alles abgewirtschaftet, Verheißung wie Schreckgespenst. Symptomatisch die Philosophie mancher Versammlungsteilnehmer: „Ich gehe nicht in eine Partei, man hat jetzt gesehen, wohin man kommt, wenn man in der Partei war, wer weiß, was in weiteren zwölf Jahren ist . . .“ Also empfiehlt sich, wie der Schweizer Essayist Hans Albrecht Moser einmal gesagt hat: „In dieser Welt von heute Feigheit von selbst.“
Das Mißtrauen, einmal rege, stieg. Hätte nicht die Kommunistische Partei von Rechts wegen jetzt Demokratische Partei heißen müssen? Denn was trennte sie eigentlich noch von den anderen, da sie gleich ihnen sich zur Demokratie bekannte? Im Gefühlsarsenal des Volkes bestanden die Trennungswände der Vergangenheit fort. Hie Diktatur des Proletariats, hie sozialistische Demokratie. Hie Marxismus, hie Bürgertum. Dementsprechend rekrutierten sich nun die Mitglieder der Berliner „Großen Vier“. Was aber war Schein, was Wirklichkeit? War es nützlich, daß verwischt wurde, was einmal nicht ohne Grund verschieden gewesen war? Würde die negative Sammlungsparole „Antifaschismus“ standhalten, wenn es einmal um positive Entscheidungen gehen sollte? Was war „christlichsozial“, was „liberal-demokratisch“? Waren die einen religiös, die anderen materialistisch? Betonten die einen mehr das göttliche Recht, die anderen mehr das Handelsrecht? Welche historischen Erinnerungen, welche Leistungen, welche Fragwürdigkeiten waren mit den Namen unter den Aufrufen verknüpft? Jünger würden sie unterdessen auch nicht gerade geworden sein ... Dies und mehr war das „Volksrhabarber“, das den Auftritt der neuen Parteileute begleitete. Wer die Mitgliedschaft anmeldete, tat es meist aus der Sentimentalität gegenüber der eigenen Vergangenheit. Arbeiter, Handwerker, Kaufleute, Juristen, Aerzte, Künstler gingen dorthin, wo sie früher gewesen waren, gingen, um alte Bekannte zu treffen und der alten Fahne die Treue zu halten, gingen oder blieben.
So war die Situation bis in den September hinein. Seitdem aber hat sie sich durch zwei Momente erheblich geändert. Die Geister der Berliner „Einheitsfront“ schieden sich an den ersten praktischen Problemen, die, jenseits des klischierten Vollmondscheins schöner, von alters her bekannter und jedem Versagen zugrundeliegender Rhetorik, an einem dunkleren Horizont auftauchten. Da war die Bodenreform, da war die konfessionelle Schule mit der besonderen Streitfrage des Religionsunterrichtes. Eine Zeitung kam auf den Gedanken, die Vorsitzenden der vier Parteien zu befragen. Pieck von den Kommunisten antwortete: „Gerade dadurch, daß die demokratisch und antifaschistisch gesinnten Teile unseres Volkes, vertreten durch ihre Parteien, einheitlich an die Schaffung und Vervollkommnung der Demokratie gehen, wird die Einheit unseres Volkes sichergestellt.“ Die nächste Nuance brachte Fechner von den Sozialdemokraten: „Die Diskussion etwa strittiger Fragen im Schoße der Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien bis zur Klärung der mit dem Ergebnis übereinstimmenden Fragen der Nation kann niemals dem Prinzip und Geist der Demokratie widersprechen.“ Hermes tat für die christlich-demokratische Union einen weiteren Schritt: „Es würde ein Mißverstehen der Demokratie bedeuten, wenn eine solche Zusammenarbeit die Vertretung der abweichenden Meinungen der einzelnen Parteien einschränken oder gar unmöglich machen würde; in einem solchen Falle wäre di e Einheitsfront nur eine Tarnung , um einer bestimmten Richtung eine Vorherrschaft zu sichern.“ Und, wenn man so sagen darf, am weitesten links stellte sich Koch mit den Liberal-Demokraten: „Bei der Landreform ist es zwar zu einer äußerlichen Einigung über eine gemeinsame Resolution gekommen; indessen war dies nur möglich, indem die wesentlichen Punkte, in denen die Auffassungen der Parteien differierten, aus der Resolution herausblieben.“
Ein weiteres Moment stellte die Entwicklung in einen größeren, gesamtdeutschen Rahmen. Es fing mit dem Zeitpunkt zu wirken an, als auch in den amerikanischen und britischen Besetzungszonen Parteien wieder zugelassen wurden. Hier vollzog sich der Aufbau nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, aus den Wünschen und Anregungen der Bevölkerung heraus. Aus örtlichen Gruppen entstanden regionale Zusammenschlüsse. Mit den vier in Berlin präsentierten Parteien hatten sie häufig nicht einmal den Namen gemein, und wenn den Namen, so kaum das Programm. Die Blockbildung fand wenig Anklang; statt dessen tauchten auch dort, wo die Parteien alte Namen trugen, neue Gesichtspunkte auf. Wir haben diese Bewegung, die auf eine größere Beweglichkeit des Geistes schließen läßt, fortlaufend registriert, so daß wir für aufmerksame Leser nichts wiederholen müssen. Die Berliner Beschränkung auf vier Parteien könnte als Vorteil gegenüber der Vielfalt der Neugründungen im Nordwesten und Süden erscheinen. Aber einerseits zeigt sich dort, daß es auch ohne „Einheitsblock“ möglich ist, den Kampf aller gegen alle zu vermeiden; andererseits kristallisiert sich gerade dort am deutlichsten ein Zukunftsbild heraus, das, wenn nicht alles trügt und erst einmal alle Schminke abgewaschen sein wird, die Züge des Zweiparteiensystems zeigt.
Es begann mit dem sozialdemokratischen Parteitag in Hannover und den Verschmelzungsbestrebungen der SPD und KPD in Berlin; die vorläufigen Höhepunkte bildeten die Reden von Schumacher in Kiel und Grotewohl bei der Revolutionsfeier in Berlin. Einerlei, ob in Berlin zentrifugale Kräfte die Verschmelzung noch eine Weile verhindern werden, kommen wird sie doch, weil sie das Natürliche ist, nachdem einmal die KPD auf die sofortige Einführung des Sowjetsystems verzichtet und die SPD sich deutlich unterscheidender Thesen begeben hat. Den Umständen nach kann das Resultat nur eine extrem-sozialistische Partei sein. Steuert die SPD die größere Mitgliedermasse bei, so darf die KPD die größere Robustheit und doktrinäre Energie für sich buchen. Im bürgerlichen Lager müßte der Zusammenschluß der beiden demokratischen Parteien zu einer wirklichen „Union“ die zwangsläufige Folge sein. Warum sollen, wenn sich die Konfessionen bei den Christlich-Demokratischen vertragen können, die freigeistigen Liberalen sich nicht mit den Religiös-Konfessionellen vertragen? Wie hinter jeder anderen Berliner Linie, so werden auch hier die föderalen Länder Sachsen, Thüringen, Mecklenburg und die Provinz Brandenburg vermutlich nachhinken. Was Oldenburg, Rheinland-Westfalen und Schleswig betrifft, so ist die SPD dort im Begriff, als eine Art deutscher Labourparty Arbeiterschaft und fortschrittliches Bürgertum zu sammeln. Daneben werden die Kommunisten und zunächst einige konservative Splitter, auch Teile des alten Zentrums, bestehen bleiben. Aehnliches könnte sich im Süden ereignen. In Groß-Hessen und Württemberg-Baden würden der SPD mehr die bürgerlich-demokratischen Elemente der achtundvierziger Prägung, in Bayern mehr die katholischen Elemente der ehemaligen Bayerischen Volkspartei gegenüberstehen. In allen Industrierevieren wird mit einer starken kommunistischen Partei zu rechnen sein.
All das ist keine Prognose; es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber Voltaire ist im Recht: „Wenn diese barbarische Gleichgültigkeit der wahre Naturinstinkt wäre, müßte die Gattung Mensch es doch wohl immer so getrieben haben.“ Da das nicht der Fall ist, muß auch diese Stumpfheit, diese Dumpfheit von Menschen überwunden werden können, die, wenn überhaupt irgendwohin, zurückgewandt sind, weit zurück, in die zwanziger Jahre, bis 1910, ja bis 1900 hinunter.
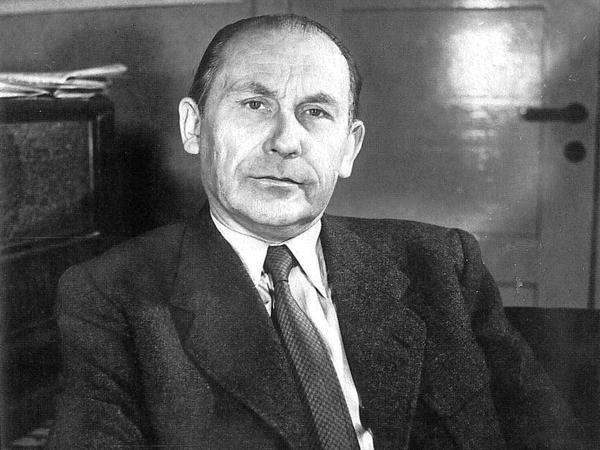
© Tsp-Archiv
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: