
© Amanda Dahms
Ständig sind alle nur getresst: Wie komme ich endlich mal runter, Frau Easwaran?
Durchatmen, an Kaiserschmarrn denken. Medizinerin und Bestsellerautorin Karella Easwaran über wirklich wirksame Entspannungstechniken – und den Willen zum Glück.
Stand:
Frau Easwaran, Sie sind Ärztin und Glücksexpertin. Einer Ihrer Tricks ist, in Situationen, die Frustration, Ärger oder Enttäuschung auslösen, an Kaiserschmarrn zu denken. Warum bloß?
Weil wir den oft gegessen haben in Österreich auf den Hütten beim Skifahren. Ich habe mich oft gefragt, wie bereitet man das zu? Indem ich daran denke, also an irgendwas anderes als an meinen Ärger, komme ich runter. Denn dadurch wechsle ich auf eine andere Nervenbahn, so ähnlich wie man auf der Autobahn die Spur wechselt – runter vom Stress-Highway! Dieser Switch legt den Schalter um im Kopf und ich muss nicht den Ärger weiter- und wiederkäuen. Statt an Kaiserschmarrn können Sie auch ans Fensterputzen denken. Hauptsache, Sie kommen aus dem Mist raus.
Betrüge ich mich mit dieser Art von Konditionierung nicht selbst?
Was ist denn so schlimm daran, wenn beispielsweise ein Termin verschoben wird oder Dinge nicht so laufen wie geplant? Der größte Betrug an sich selbst ist es, auf kleine Dinge so zu reagieren, als wären sie lebensbedrohlich. Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch eine Form der Selbstvergiftung. Die Stresshormone belasten Herz, Kreislauf, Immunsystem und Stoffwechsel – und machen uns krank.
Man sollte sich also nur aus guten Gründen aufregen?
Ja, Aufregung versetzt den Körper in einen angespannten Zustand, der nur erforderlich ist, wenn wir unser Leben schützen wollen. Es ist eine Mobilisierung der Kräfte, damit wir eine Kampfansage machen können. Leider erkennen wir oft nicht den Unterschied zwischen „Gefahr“ und „Keine Gefahr“. Ich könnte mich beispielsweise über ein Kaugummi aufregen, das achtlos auf die Straße gespuckt wurde. Aber das nutzt nichts. Denn in diesem Zustand finde ich erst recht keine Lösung für diese Art Problem.
Die evolutionär frühe Reaktion, nämlich uns aufzuregen, das sollten wir allenfalls bei Todesangst zulassen. Dann dürfen wir schreien, schlagen, kämpfen – auch flüchten oder uns tot stellen. Im Alltag ist es aber leider so, dass Aufregung zu einer Gewohnheit geworden ist. Die haben wir in der Kindheit eingeübt.
Es ist Betrug an sich selbst, auf kleine Dinge so zu reagieren, als wären sie lebensbedrohlich.
Karella Easwaran, Ärztin und Glücksexpertin
Ihre Botschaft ist: erstmal runterfahren?
Ja. Und die gute Nachricht ist: Wir können lernen, uns nicht aufzuregen. Dann gelingen uns Dinge, wir können kreativ sein, können denken. Denken ist nicht emotional, es ist auf Problemlösungen ausgerichtet. Das brauchen wir auch gesellschaftlich gerade jetzt, wo kollektives Kampfverhalten umgeht, die gegenseitige Ansprache ist rau und harsch. Doch wer kämpft, der zerstört. Entwickeln können wir uns nur, indem wir den Kampfgeist dämpfen.
Und wie können wir glücklich werden?
Glück entsteht in Kopf, es ist ein neurochemischer Prozess. Stress blockiert das Glück. Weil wir Stress bekämpfen können, sind wir selbst und ganz allein für unser Glück verantwortlich.
Diesen Prozess können wir auch mit Drogen auslösen, oder?
Drogen können Glück nur simulieren, das gilt für jede Art von Suchtverhalten. Der Höhepunkt ist hier gekoppelt an einen tiefen Fall. Glück dagegen ist verbunden mit einem anhaltenden Wohlbefinden im Innern. Wir erreichen ein höher gelegenes Basiscamp, in dem es uns gut geht. Natürlich haben wir beispielsweise auch Freude an schönen Dingen, die wir einfach kaufen können. Aber die Freude hält nicht an, es ist kein stabiler Zustand. Glück erreichen wir nur durch einen inneren Frieden.
Was ist für Sie die Glücksformel?
Die Beobachtung unserer Emotionen – und die Bändigung des Krokodils, wie ich diese tief verankerte Kampfbereitschaft nenne. Wir sind lernfähig, wir können uns neu verdrahten. Das beneficial thinking, das ich vorschlage, ist eine Methode, das Leben aktiv in einem glücklicheren Zustand zu gestalten, statt es passiv zu ertragen.
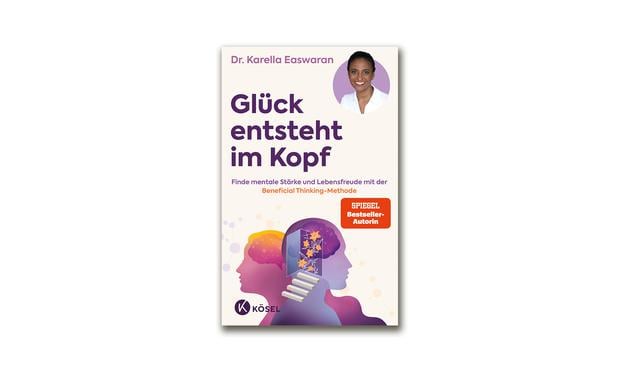
© Kösel Verlag
Womit fange ich konkret an?
Durch die Wahrnehmung dessen, was mich stört. Jedes Mal, wenn ich mich im Laufe des Tages aufrege, schreibe ich auf, worüber. Das schaue ich mir abends an und frage mich: Welche dieser Situationen war lebensbedrohlich? Vermutlich keine einzige. Wenn mir das bewusst wird, schult es mich, und ich nehme Dinge allmählich anders wahr, weniger bedrohlich.
Darf man nicht auch mal zornig oder traurig sein?
Doch, natürlich. Emotionen haben einen Sinn. Zorn oder Traurigkeit zeigen uns, dass uns etwas wichtig ist oder dass wir etwas verloren haben. Das ist gesund. Aber es ist nicht sinnvoll, diese negativen Gefühle unnötig lange festzuhalten. Wenn ich sie ständig aufrechterhalte, obwohl keine Gefahr besteht, belaste ich meinen Körper und mein Denken – und genau das wollen wir vermeiden.
Laut TK-Stressreport fühlen sich aktuell zwei Drittel der Menschen in Deutschland in Alltag oder Berufsleben gestresst. Erklären Sie uns bitte, was bei Stress passiert – und was hilft, wieder herunterzukommen.
Stress ist ein körperlicher Zustand, genauso gibt es aber ein System, das uns wieder herunterfährt. In der Medizin verorten wir das im Nervensystem und nennen es Sympathikus und Parasympathikus. Einfach gesagt, sind es die Verbindungen zwischen Gehirn und unseren Organen. Eine der wichtigsten Verbindungen ist der Vagusnerv. Der steuert auch die Atmung. Beim Ausatmen sendet der Vagusnerv ein Signal an das Gehirn, Botenstoffe freizusetzen, die das Stresssystem beruhigen. Bei Stress ist unser Atem kurz, wenn wir tief einatmen und lang ausatmen, reduzieren wir diese Anspannung. Deshalb spielen Atemübungen in vielen Disziplinen, zum Beispiel beim Yoga, eine zentrale Rolle beim Entspannen.
Das sind Wirkungen vom Körper auf das Gehirn. Gibt es auch Tricks für die umgekehrte Richtung?
Ja, indem wir rückwärts zählen, von 20 bis 1. Dadurch ist das Gehirn beschäftigt, wir konzentrieren uns auf etwas anderes als auf Stress oder Ärger auslösende Gedanken. Dafür haben wir keine Zeit, während wir zählen. Dadurch wird die Ausschüttung des Stresshormons gestoppt. Dieselbe Funktion erfüllt ein Mantra bei der Meditation. Dabei lerne ich beiläufig, meine Gedanken auf einen Punkt zu konzentrieren, auf einen Inhalt, der beruhigt.
In Ihrem Buch zitieren Sie Forscher, die eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion beobachtet haben. Warum ist das so wichtig?
Weil wir diese Lücke nutzen können. Die Reize fluten über unsere Sinne auf uns ein, wir sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Und wir können lernen, auf diese Sinnesreize anders zur reagieren als nach gewohnten oder eingeübten instinktiven Mustern, etwa gleich loszupoltern.
Dazu müssen wir vermutlich auch frühe Prägungen loswerden?
Ja, denn sehr viel von dem, was wir als Erwachsene tun, folgt Mustern aus unserer Kindheit. Oft sind es Verhaltensweisen unserer Eltern oder elterliche Gebote. Hinzu kommen Lehren aus schlechten Erfahrungen, die wir gespeichert haben. Und Glaubenssätze, die aus unserer Kultur stammen. Als Erwachsene müssen wir lernen, da rauszukommen.
Blockiert uns das auch in gesellschaftlichen Situationen?
Ja, wenn ich als Kind gelernt habe, dass meine Mutter alles für mich macht, und mir Dinge gesagt hat wie: „Du kannst das sowieso nicht“, dann prägt mich das. Ich traue mir viele Dinge auch als Erwachsener nicht zu. Ich bin mutlos. Und es beeinflusst auch mein Selbstwertgefühl. Weil ich verinnerlicht habe, dass ich nicht so viel wert bin wie andere, weil ich vieles nicht kann. An diesem toxischen Wertesystem halte ich fest, obwohl es mir schadet. Wir bauen Mauern aus Angst auf.
Dankbarkeit entstresst Menschen. Das ist neurophysiologisch nachgewiesen.
Karella Easwaran, Ärztin und Glücksexpertin
Wie reißt man die nieder?
Indem ich zuerst wahrnehme, was mich prägt und welche Gedanken mich klein halten. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich kein Wort Deutsch. Ich habe mich hingesetzt und gesagt: Ich will das jetzt lernen! Natürlich kam sofort der Gedanke: Ich kann das nicht, ich bin woanders aufgewachsen. In solchen Momenten kommt der Wille ins Spiel. Wenn ich etwas wirklich will, findet mein Gehirn einen Weg. Es beginnt nach Lösungen zu suchen, es passt sich an, es lernt. So werfen wir alte Muster über Bord: indem wir ihnen nicht glauben – und uns erlauben, etwas Neues zu wollen.
Warum sind negative Gedanken und Erfahrungen so machtvoll und bleiben so hartnäckig im Gedächtnis, viel stärker als positive?
Weil wir instinktiv nicht die Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit als das Wichtigste ansehen, sondern unser Überleben. Und das Leben scheint ständig gefährdet zu sein. Wenn uns der Verkäufer am Kiosk anschnauzt oder es auf der Arbeit Kritik hagelt, entsteht das Gefühl, zurückgewiesen und ausgeschlossen zu werden. Ähnlich ist es beim Verstoß gegen kulturelle Gebote und Verbote. Ursprünglich war ein Ausschluss aus der Gemeinschaft lebensbedrohlich. Diese Angst schwingt heute noch mit und hält uns davon ab, uns weiterzuentwickeln. Statt Strategien zum Umgang mit solchen Situationen zu entwickeln, reagiere ich mit Aggression und Wut – oder mit Rückzug, ich mache mich klein.
Sie geben auch Tipps zur Ernährung in Ihrem Buch, warum das?
Weil wir als Menschen nicht nur von unseren Gedanken, sondern auch von unseren Bewegungen und von der Nahrung gesteuert werden, die wir zu uns nehmen. Früher haben wir unsere Lebensmittel lange gekaut, bevor wir sie geschluckt und verdaut haben. Heute bietet die Lebensmittelindustrie hochverarbeitete Produkte an, die schnell gegessen, rasch abgebaut und in Zucker umgewandelt werden.
Nun ist aber unser Darm direkt mit dem Gehirn verbunden. Diese Darm-Hirn-Achse transportiert unter anderem Glückshormone wie Serotonin von der Verdauung ins Gehirn. Damit das funktioniert, brauchen die guten Bakterien im Dickdarm genügend Nahrung. Diese stammt vor allem aus Ballaststoffen, die in stark verarbeiteten Lebensmitteln fehlen.
Was passiert dann im Körper?
Weil den Bakterien die Nahrung fehlt, beginnen sie – vereinfacht gesagt – die Darmschleimhaut anzuknabbern, was langfristig die Serotoninproduktion beeinträchtigen kann. Das wirkt sich wiederum auf unsere Stimmung aus. Unsere Darmbakterien sind wie kleine Haustiere, sie brauchen die richtige Nahrung, um aktiv zu werden. Wenn wir natürliche Lebensmittel essen, beginnen sie, unter anderem Vorstufen von Serotonin zu produzieren, einem unserer wichtigsten Glücksbotenstoffe. Daher beeinflusst die Art der Nahrung, die wir essen, wie viele dieser Glückssignale entstehen und unser Gehirn erreichen. Auch Lebensmittel, die reich an Vitaminen sind – wie Kohl oder Wirsing im Winter – wirken wie kleine Sonnenstrahlen für Körper und Geist.
Ein Kapitel widmen Sie der Dankbarkeit und warum deren Ausdruck so wichtig ist. Wieso?
Wenn ich morgens aufstehe und meinem Gehirn sage: „Danke, dass ich lebe und atme“, dann versetzt mich das in einen anderen Zustand, als wenn ich an die Probleme bei der Arbeit oder im Haushalt denke. Dankbarkeit entstresst Menschen. Das ist neurophysiologisch nachgewiesen. Man findet Ruhe und Frieden.
Im Alltag ist es genauso. Wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht, ein Autounfall mit Blechschaden etwa, dann kann ich mich aufregen und schreien – oder dankbar dafür sein, dass ich nicht verletzt wurde oder Schlimmeres geschehen ist. Dann trete ich nicht in die Gedankenspirale ein: Warum ist mir das passiert, was kostet die Reparatur, was habe ich falsch gemacht? Das ist nutzloser Stress.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: