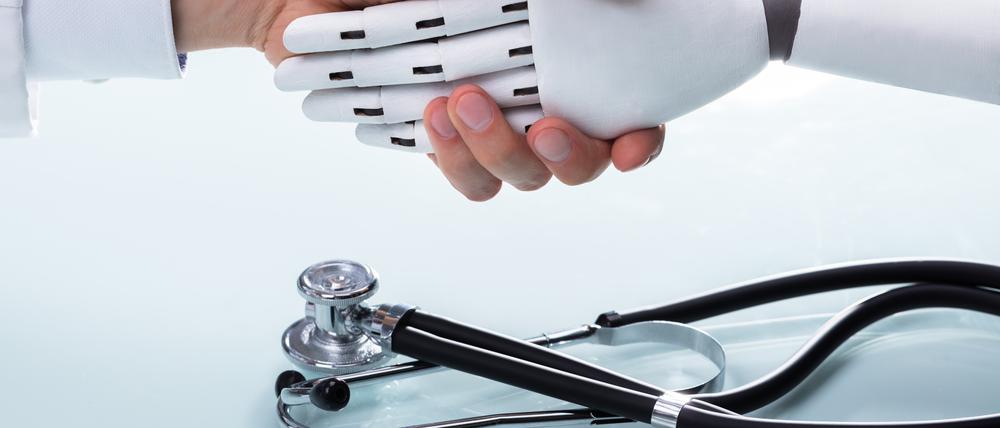
© Getty Images/iStockphoto
Werde ich in zehn Jahren zucker- oder herzkrank?: Künstliche Intelligenz sagt Risiko für 1000 Leiden voraus
Ein neues KI-Modell prognostiziert, ob ein Mensch bald erkrankt. Wie belastbar die Ergebnisse sind – und welche ethischen Probleme sich stellen. Muss man wirklich alles wissen?
Stand:
Die Vorstellung, Krankheiten vorherzusagen, sich darauf vorzubereiten oder ihren Ausbruch sogar zu verhindern, fasziniert die Menschheit, seit sie Medizin betreibt. Kleinere Schritte ist die Forschung dabei bereits vorangekommen. Früherkennungsuntersuchungen und Genanalysen ermöglichen für einzelne Erkrankungen solche Prognosen.
Doch nun soll die Künstliche Intelligenz (KI) in der Lage sein, das Erkrankungsrisiko einzelner Personen und ganzer Bevölkerungsgruppen vorherzusagen. Das geht aus einer Studie des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL), des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und der Universität Kopenhagen hervor. Die Studie erschien am Mittwoch im Fachjournal Nature.
Die KI trainierte mit den Daten von 400.000 Personen
Delphi-2M, so der Name des Modells, kann das Risiko für über 1000 Krankheiten – laut der internationalen Diagnosenklassifikation ICD – für einen Menschen mehr als zehn Jahre im Voraus prognostizieren. Bisherige Modelle konnten das nur für eine einzelne Krankheit und meist über einen kürzeren Zeitraum. Das neue KI-Modell schließt damit eine wichtige Forschungslücke.
Es geht dabei ähnlich vor wie große Sprachmodelle, die in der Lage sind, die Struktur von Sätzen zu erlernen. „Nur analysiert es nicht Sprache, sondern den medizinischen Hintergrund und die Lebensstilfaktoren der Patienten, um Muster zu erkennen“, sagt Tom Fitzgerald, Wissenschaftler am Europäischen Institut für Bioinformatik, dem britischen Science Media Center (SMC UK).
Zuverlässige Prognosen zu Infektionserkrankungen, psychischen Störungen, Schwangerschaftskomplikationen oder seltenen Erkrankungen sind deutlich schwieriger.
Moritz Gerstung, Deutsches Krebsforschungszentrum
Im Rahmen der Studie trainierte die Forschungsgruppe ein sogenanntes „Generative Pre-trained Transformer“-Modell (GPT-Modell) mit den Daten von 400.000 Personen aus der UK Biobank. Die britische Datenbank enthält anonymisierte Gewebeproben und gesundheitsbezogenen Informationen von rund einer halben Million Menschen. Die Daten umfassten klinische Diagnosen sowie Angaben zu Body-Mass-Index, Geschlecht und Alkohol- und Nikotinkonsum.
Nach dem Training wurde das System an Daten von 1,9 Millionen Patienten aus dem Dänischen Nationalen Patientenregister erfolgreich getestet.
Das Modell prognostiziert nur Wahrscheinlichkeiten
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Vorhersagekraft von Delphi-2M ähnlich gut oder sogar besser war als die von Modellen, die nur einzelne Erkrankungen voraussagen. Die KI liefere den Studienexperten zufolge allerdings keine Gewissheiten, dass bei einer Person diese oder jene Erkrankung ausbrechen wird. Sie prognostiziere – ähnlich wie Wettervorhersagen – nur Wahrscheinlichkeiten. Und wie bei den Wetteraussichten seien die Vorhersagen für die nächste Zeit deutlich zuverlässiger als langfristige Prognosen.
Die Genauigkeit hängt zudem von der jeweiligen Erkrankung ab: Je mehr qualitativ hochwertige und vielfältige Daten über eine Krankheit vorliegen, desto präziser sind die Vorhersagen. „Während die KI zuverlässige Prognosen zu Diabetes, Herzinfarkten, Blutsepsis oder bestimmte Krebsarten treffen kann, ist dies bei Infektionserkrankungen, psychischen Störungen, Schwangerschaftskomplikationen oder seltenen Erkrankungen zum Beispiel deutlich schwieriger“, sagt Moritz Gerstung, Leiter der Abteilung für Künstliche Intelligenz in der Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem SMC UK.
Qualität der Datensätze beeinflusst Aussagekraft des Modells
Außerdem kann es bei Datensätzen wie denen der UK Biobank dazu kommen, dass bestimmte Personengruppen, beispielsweise nach Alter oder ethnischer Zugehörigkeit, über- oder unterrepräsentiert sind. Dies beeinflusst die Aussagekraft des Modells erheblich, wie die Forscher betonen.
Klar ist daher, dass die praktische Einführung einer solchen KI noch Jahre dauern und mehrere Kontroll- sowie Validierungsphasen durchlaufen wird. „Dafür braucht es die Zusammenarbeit interdisziplinärer Teams aus klinischer Forschung, Epidemiologie und KI“, sagt Moritz Gerstung.
Eine direkte Anwendung in der Praxis sei ohnehin nicht das primäre Ziel der Forschenden gewesen: Zunächst soll das Modell weiter erforscht und mit zusätzlichen Daten, etwa Blutwerten, ergänzt und optimiert werden. Die Autoren der Studie schätzen, dass eine mögliche Einführung in den klinischen Alltag in etwa fünf bis zehn Jahren erfolgen könnte.
Wenn wir das Modell um Daten von Wearables erweitern würden, könnten Nutzerinnen und Nutzer nachvollziehen, wie stark sich ihr Risiko für Krankheiten wie Demenz durch Sport verringert hat.
Carsten Marr, Helmholtz Zentrum München
Doch wie könnte eine Zukunft aussehen, in der eine KI vorhersagt, dass man krank wird? „Nehmen wir an, die elektronische Patientenakte speichert meine Gesundheitsdaten der vergangenen Jahre, und diese werden in das Modell eingespeist“, sagt Carsten Marr, Direktor des Institute of AI for Health am Helmholtz Zentrum München und Professor für Künstliche Intelligenz in Zelltherapie und Hämatologie an der Medizinischen Fakultät und Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, dem SMC. „Wenn wir das Modell um Daten von Wearables erweitern würden, könnten Nutzerinnen und Nutzer über Gesundheits-Apps nachvollziehen, wie stark sich ihr Risiko für Krankheiten wie Demenz durch Sport verringert hat.“
Darüber hinaus könnte man laut Marr mit dem Modell möglicherweise bisher unbekannte Zusammenhänge zwischen Krankheiten aufdecken. „Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass eine Epstein-Barr-Virus-Infektion das Risiko für Multiple Sklerose um das 30-Fache erhöht. Genau solche Zusammenhänge suchen wir.“
Einführung muss sorgfältig geprüft werden
Obwohl das Modell individuelle Prognosen erstellt, könnte es mittelfristig auch auf Bevölkerungsebene eingesetzt werden. „Konkret könnte die KI den kollektiven Gesundheitsbedarf der kommenden zehn Jahre vorhersagen, sodass sich regionale Gesundheitssysteme zum Beispiel entsprechend darauf einstellen können“, sagt Moritz Gerstung.
Manchmal aber sind einfache Datenerhebungen, die jeder Arzt in seiner Praxis oder im Labor durchführen kann, viel einfacher, als eine aufwändige KI-Analyse. „So schneidet das Modell bei Diabetes schlechter ab als ein einfacher Laborwert wie der HbA1c es tun würde“, sagt Julian Varghese, Direktor des Instituts für Medical Data Science an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, dem SMC. Der Hämoglobin A1c zeigt den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten zwei bis drei Monate.
Darüber hinaus seien die Vorhersagen für seltene Erkrankungen wegen der geringen Fallzahlen wenig belastbar. „Schließlich sind auch Aussagen für sehr alte Patientinnen – über 80 Jahre alt – und für Krankheiten mit hoher Mortalität, wie etwa bestimmte aggressive Krebsarten, unsicher, weil diese Gruppen im Trainingsdatensatz der UK Biobank kaum oder nur verzerrt vertreten sind“, sagt Varghese.
Neben den Unsicherheiten in der Prognose gibt es auch weitere, grundsätzliche Themen zu beachten: ethische Regeln. Die Experten betonen, dass Modelle wie Delphi-2M den Entscheidungsspielraum sowie die Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten keinesfalls einschränken dürfen. Dies schließe ausdrücklich das Recht auf Nichtwissen ein.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass KI-Modelle wie Delphi-2M Begehrlichkeiten bei Versicherungen oder Arbeitgebern – insbesondere über Deutschland mit seinen strengen Datenschutzregeln hinaus – wecken könnten. Das könnte dazu führen, dass Menschen ungerechtfertigt benachteiligt werden, beispielsweise bei einem Abschluss von Lebensversicherungen. Daher müsse sorgfältig geprüft werden, wo und auf welche Weise solche Modelle im Gesundheitssystem angewendet werden.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: