
© Helmut Reinelt; Etienne Beothy VG Bild Kunst 2025
Arp Museum Rolandseck: Wie eine Pariser Gruppe mit abstrakter Kunst Widerstand leistete
In den Jahren 1931 bis 1937 kämpft ein internationales Netzwerk in Paris für die Freiheit der Kunst und gegen den Faschismus. Eine spektakuläre Ausstellung in Remagen vereint die Mitglieder nun wieder.
Stand:
Bis zum Zweiten Weltkrieg galt Paris als Welthauptstadt der Kunst. Wer als Künstler einen Markt suchte, ging in die Stadt mit ihren zahllosen Galerien und Sammlern. Wer Kontakt zu Gleichgesinnten suchte, ging ebenfalls nach Paris.
Beide Motive fließen zusammen in der Gründung der Gruppe „Abstraction – Création“ im Frühjahr 1931. Die Vertreter ungegenständlicher Kunst suchten den Zusammenhalt, um sich gegen andere Stilrichtungen zu behaupten, aber zugleich, um im Kunstmarkt eine Lücke zu finden.
Als Organisation hielt die Gruppe sechs Jahre lang. Nie trat die ungegenständliche Kunst so kompakt und sichtbar auf, unterstützt durch eine eigene Zeitschrift und einen eigenen Ausstellungsraum.
Es ist schon bald fünfzig Jahre her, dass die Gruppe in einer Museumsausstellung gewürdigt wurde, das war 1978 in Münster. Diese lange Pause beendet nun das Arp Museum Rolandseck in Remagen mit seiner Ausstellung „Netzwerk Paris“, die die Künstler der Gruppe und ihre Werke wieder vereint.
Hans Arp und Sophie Taeuber in Paris
Kein Museum wäre berufener, trägt es doch den Namen zweier Gründungsmitglieder, Hans (Jean) Arp und Sophie Taeuber-Arp. Beide lebten ab etwa 1930 in Paris – und stehen für die beiden Wurzeln der ungegenständlichen Kunst. Sie konnte aus Formen der Natur abgeleitet sein, daher „Abstraction“, oder gänzlich aus geometrischen Formen gebildet, daher „Création“.
Für Ersteres steht Hans Arp, der Urformen aus der Natur in die dritte Dimension von Skulpturen überführt, für Letzteres Sophie Taeuber-Arp, die aus Linien und Flächen rhythmisch-geometrische Räume baut. Beide waren um 1915 bereits Mitbegründer der pazifistischen Dada-Bewegung in der Schweiz.
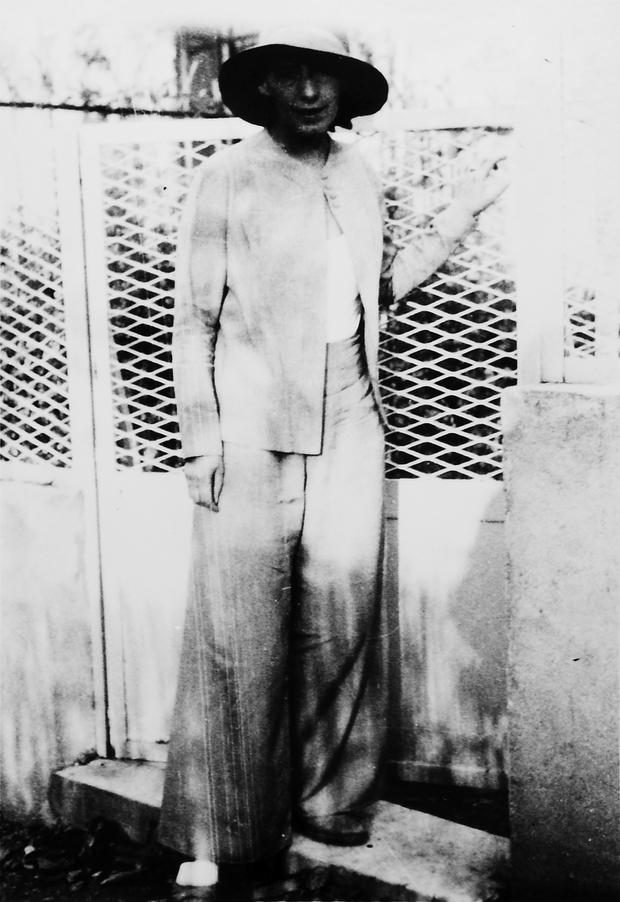
© Stiftung Arp e.V., Berlin/Rolandswerth
Es gab Vorläufer in Paris, Piet Mondrian mit seinen rechtwinkligen Bildaufbauten, und seinen Mitstreiter Theo van Doesburg. Beide waren als Vorkämpfer neuer Kunst hervorgetreten und hatten Erfahrung im Auftritt von Künstlergruppen. Insofern konnte „Abstraction – Création“, am 16. März 1931 offiziell aus der Taufe gehoben, an Erfahrungen wie Netzwerke anknüpfen.
Uneins in Sachen Stil und Farbe
Das Gruppenleben verlief nicht ohne Reibungen. Man kann sie erahnen, durchwandert man die schön gegliederten Ausstellungsräume im Arp-Museum. Der Auftakt gebührt dem „Neoplastizismus“, wie Doesburg seine neue, dogmatisch gereinigte Kunst genannt hatte; die Einflüsse aus dem revolutionären Sowjetrussland sind deutlich. Mondrian beharrte auf Rot, Blau und Gelb; der Belgier Georges Vantongerloo, der bald eine führende Rolle in der Gruppe einnahm, ließ auch Grün zu.
Mehrere Gruppenmitglieder folgten Mondrian, fanden aber zu eigenständigen Schöpfungen, wie der Franzose Jean Gorin, der die Malerei in die dritte Dimension ausbaute, und die Engländerin Marlow Moss, die gerade wegen ihres Verzichts auf Farbe dem hier benachbarten Mondrian-Opus Paroli bietet.

© Ville de Grénoble/Musée de Grénoble/N. Pianfetti
Unter den gut insgesamt wohl mehr als 400 Künstlern aus 20 Nationen, die im Laufe der Jahre als Mitglieder der Gruppe geführt wurden, gab es zwar nur eine überschaubare Anzahl von Frauen. Die aber stechen durch ihre Eigenständigkeit heraus. Barbara Hepworth, die einzigartige und in Deutschland noch immer kaum bekannte Bildhauerin, ist zu nennen, oder die Irin Mainie Jellett, von der eine geradezu farbtrunkene Komposition zu sehen ist. Und natürlich Museumspatin Sophie Taeuber, die immer neue Wege einschlug.
Nur abbildhaft durfte nichts sein. Insofern irritiert das Gemälde der Britin Paule Vézelay, das seinem Titel gemäß eine „Sammlung von Objekten auf einem blauen Tisch“ zeigt. Da deutet sich Nachbarschaft zum Surrealismus an, der lautstarken, um 1930 dominierenden Richtung. Die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift war für „Abstraction – Création“ der logische Schritt, auf Dauer Gehör zu finden. In jedem Jahr kam ein Heft heraus, bis 1936; im Folgejahr löste sich die Gruppe auf. Der eigene Ausstellungsraum musste bereits Ende 1934 schließen.
Erst die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg brachte die uneingeschränkte Anerkennung der „Abstraktion als Weltsprache“, wie sie die zweite Documenta 1959 behauptete. Viele Gruppenmitglieder lebten da nicht mehr. Mondrian starb 1944 im New Yorker Exil, Kandinsky, auch er Gruppenmitglied, ebenfalls 1944 in Paris, und Robert Delaunay bereits 1941. Otto Freundlich, in Rolandseck mit einem Hauptwerk vertreten, wurde 1943 im KZ ermordet.
„Wir stellen dieses Heft Nr. 2 unter das Zeichen des totalen Widerstands gegen jede Form von Unterdrückung, welcher Art sie auch immer sei“, hatte die Gruppe ihrer Zeitschrift programmatisch vorangestellt.
Diese Ausstellung erinnert daran, dass die ungegenständliche Kunst kein Eskapismus war, sondern ein bewusster Ausdruck des Freiheitsstrebens, der die Moderne von Anbeginn leitet.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: