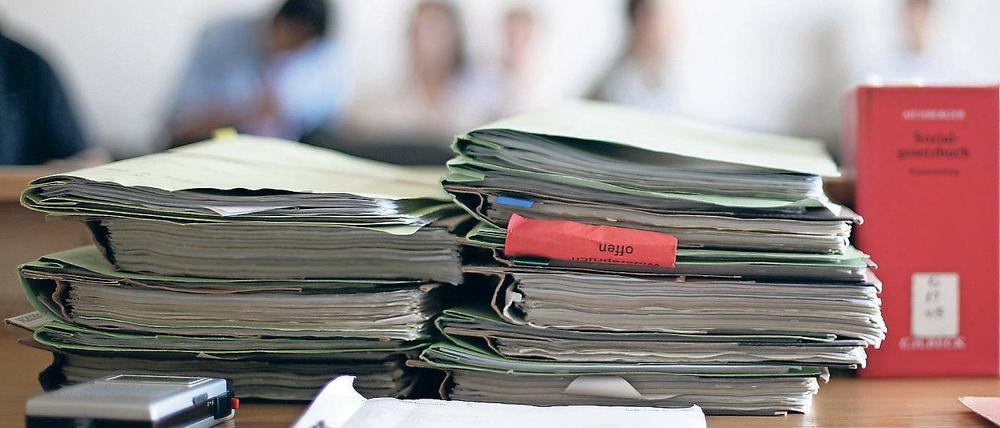
© Archiv
Brandenburg: Blockade über die Landesgrenze
Warum bei den gemeinsamen Obergerichten von Berlin und Brandenburg Reformbedarf besteht
Stand:
Cottbus - Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) wollte einen Erfolg vermelden. Anlass war Festveranstaltung im Cottbuser Konservatorium am gestrigen Freitag. Dort wurde Thomas Stapperfend feierlich in das Amt des Präsidenten des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg eingeführt, das er bereits Mitte Oktober 2016 angetreten hatte. Ludwig erklärte, die Fusion der Finanzgerichte in Berlin und Brandenburg vor zehn Jahren seien ein Erfolg. „Die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg funktioniert hier hervorragend und kann beispielgebend für andere Bereiche der Landesverwaltung sein“, sagte Ludwig.
Doch dabei kann durchaus bezweifelt werden, ob der nach der gescheiterten Länderfusion von 1996 per Staatsvertrag vereinbarte Aufbau von vier gemeinsamen Obergerichten tatsächlich ein Erfolg ist. Sitz des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ist seit 2007 Cottbus. Es bearbeitet unter anderem Klagen von Unternehmen und Bürgern zu Steuerrechtsstreitigkeiten. Doch zwischen den beiden Bundesländern Berlin und Brandenburg gibt es immer wieder Abstimmungsprobleme, bei der Zusammenarbeit hakt es. Die gemeinsamen Gerichte werden immer wieder von höchster Stelle in ihrer Arbeit behindert – durch Gerangel ums Personal.
Bis Thomas Stapperfend im Oktober Präsident des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg werden konnte, war der Posten seit Januar 2015 – also ein Jahr und neun Monate – nicht besetzt, nachdem Stapperfends Vorgänger Claus Lambrecht in den Ruhestand gegangen war.
Probleme gibt es auch beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Berlin und beim Landessozialgericht (LSG) in Potsdam, beide im Juli 2005 eingerichtet, und beim 2007 gegründeten Landesarbeitsgericht in Berlin.
Am Landesarbeitsgericht war die Präsidentenstelle von März 2013 bis April 2014 nicht besetzt, also ganze 14 Monate. Der Posten des Vize-Präsidenten war sogar noch länger vakant – nämlich zwei Jahre und sieben Monate von April 2011 bis Oktober 2013. Besonders fatal dort war die Lage, weil beide Stellen parallel acht Monate lang, von März 2013 bis Oktober 2013, nicht vergeben waren, das Gericht also führungslos blieb.
Das Oberverwaltungsgericht hatte fast zwei Jahre, genau 23 Monate, von Januar 2012 bis November 2013, keinen Präsidenten. Und in der Anfangszeit, von Juli 2005 bis Februar 2006, gab es für acht Monate nicht einmal einen Vize-Präsidenten.
Prekär ist die Lage auch am Landessozialgericht in Potsdam. Dort gab es zwei Mal keinen Präsidenten. Erst von November 2008 bis Mai 2009 für sieben Monaten. Und aktuell gibt es bereits seit drei Jahren keinen Präsidenten. Seit Januar 2014 ist der Posten unbesetzt. Grund ist jahreslanges Gerangel zwischen der lange CDU-geführten Justizsenatsverwaltung in Berlin und dem von der Linken regierten Justizministerium in Potsdam, aber auch innerhalb des vormaligen rot-schwarzen Berliner Senats. Das Bewerbungsverfahren war mehrfach neu gestartet worden. Dabei hatte sich bereits in der ersten Runde Sabine Schudoma durchgesetzt, die Präsidentin des Sozialgerichts Berlin, des größten Deutschlands. Nach mehreren Runden sollte sie nun das Landessozialgericht übernehmen, der gemeinsame Richterwahlausschuss beider Bundesländer segnete die Personalie ab. Es fehlen nur noch formale Beschlüsse vom Berliner Senat und der Landesregierung in Potsdam. Doch dazu kommt es vorerst nicht. Die Besetzung ist blockiert. Ein bei der Auswahl unterlegener Leipziger Bundesverwaltungsrichter hat ein Konkurrentenverfahren am Verwaltungsgericht Potsdam gestartet. Per Eilverfahren will er vorerst verhindern, dass Schudoma die Ernennungsurkunde ausgehändigt wird.
Seit Oktober 2016 ist das Gericht komplett führungslos. Der Vize-Präsident ging in Pension, ein neuer wurde erst Ende Dezember gewählt, er wird voraussichtlich im Februar ernannt. Bereits in der Startphase des Gerichts war der Posten für 16 Monate nicht besetzt, dann noch einmal im Jahr 2013 für drei Monate.
Zusammengerecht waren die acht Leitungsposition an den vier gemeinsamen Obergerichten 13 Jahre und drei Monate nicht besetzt. Das Problem bei den gemeinsamen Gerichten ist ein Konstrukt im Staatsvertrag. Denn die Chefposten müssen von beiden Landesregierungen einvernehmlich besetzt werden. Die Folge: Die eigentlich gern für die Zusammenarbeit der beiden Bundesländer gepriesenen Obergerichte sind alles andere als als Vorzeigeprojekte, ihre Arbeit wird blockiert. Offensichtlich besteht Reformbedarf. Eine Lösung mit schlankeren Verfahren für die Stellenbesetzung wäre möglich, wie es in der Justiz heißt. Dazu aber müsste der Staatsvertrag geändert werden. Die Chefposten könnte von jeweils der Landesregierung besetzt werden, in deren Bundesland das gemeinsame Obergericht seinen Sitz hat. Dann wäre Brandenburg für das Finanzgericht Cottbus und das Landessozialgericht in Potsdam zuständig, Berlin für das Oberverwaltungsgericht und das Landesarbeitsgericht.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: