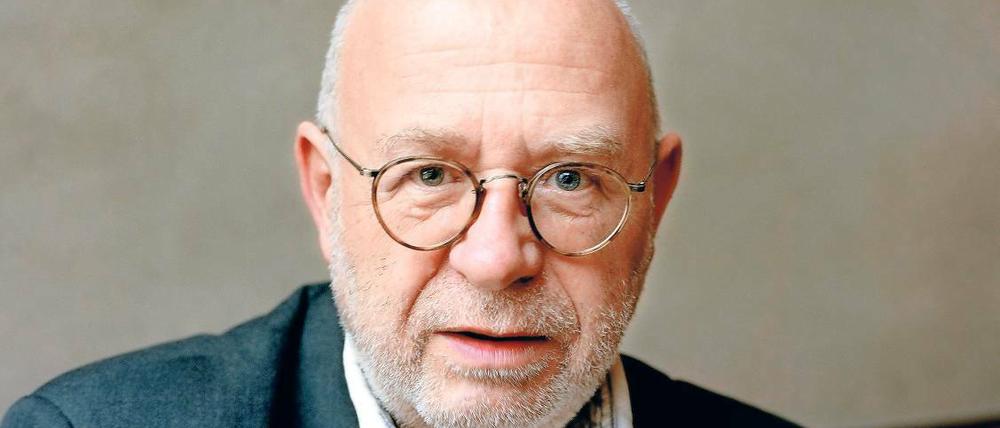
© Roland Stelter/ Promo
Interview zum Völkermord an den Armeniern: „Den Genozid in Kauf genommen“
Der Direktor des Potsdamer Lepsiushauses, Rolf Hosfeld, über Verstrickungen der deutschen Reichsregierung in den Völkermord an den Armeniern 1915, Hintergründe und die Bezüge, die später von den Nationalsozialisten zu dem Genozid hergestellt wurden.
Stand:
Herr Hosfeld, Ihr jüngst erschienenes Buch „Tod in der Wüste“ wird bereits lebhaft diskutiert. Aber weiß man hierzulande schon genügend über den türkischen Völkermord an den Armeniern während der Jahre 1915 und 1916?
Das Wissen über diesen ersten modernen Genozid des 20. Jahrhunderts hat sich, denke ich, während der letzten Jahre in Deutschland deutlich vergrößert. Daran haben Publikationen, Medienberichte, wissenschaftliche Konferenzen, neue Filme, Theaterstücke, aber auch pädagogische Lehrmaterialien einen unschätzbaren Anteil.
In seinem Potsdamer Haus in der Großen Weinmeisterstraße schrieb der evangelische Theologe Johannes Lepsius 1915 den berühmten „Bericht über die Lage des Armenischen Volkes in der Türkei“. Lepsius war eine deutsche Ausnahme. Weshalb blieb er damit so verhältnismäßig allein?
Johannes Lepsius, der sich 1915 für eine geraume Weile in der Türkei aufhielt und das Grauen aus nächster Nähe mitbekam, verfasste diesen Bericht binnen weniger Monate, doch zählte er über Jahrzehnte hinweg zu den profundesten Dokumentationen über dieses Verbrechen am armenischen Volk. Lepsius ließ von dem 300-seitigen Bericht 20 500 Exemplare drucken, auf eigene Initiative hin, und damit machte er sich nach geltendem Kriegsrecht im Prinzip sogar strafbar. Vor allem über kirchliche Kanäle versuchte er den Bericht dann in der Gesellschaft zu streuen. Er erreichte viele Adressaten, aber die Wirkung blieb begrenzt.
Warum?
Die deutsche Bevölkerung befand sich in einer recht prekären Lage durch die allgemeine Kriegssituation. Man hatte ganz einfach andere, vordringlichere Sorgen – allgemeiner Versorgungsmangel, Hunger und Krankheiten beispielsweise –, und die Presse legte ihrerseits Wert darauf, die Verbrechen an den Armeniern herunterzuspielen beziehungsweise zu vertuschen.
Halten Sie es für möglich, dass sich nach Auswertung aller historischen Quellen doch herausstellt, dass es eine aktive deutsche Verstrickung in den Genozid an den Armeniern – etwa durch die in der Türkei stationierten Offiziere und Soldaten – gegeben haben könnte?
Den einschlägigen historischen Akten im Berliner Auswärtigen Amt kann zweifelsfrei entnommen werden, dass die deutsche Reichsregierung spätestens Anfang Juli 1915 im Bilde war über die erklärte Absicht der damaligen osmanischen Regierung, – ich zitiere wörtlich – „die armenische Rasse im Türkischen Reich zu vernichten“. Damit war klar, dass ein staatlich organisierter Genozid im Gange war, den der Kriegsverbündete Deutschland billigend in Kauf nahm. Wenn man allerdings die Frage aufwirft, ob die deutschen Militärs, die ja zu jener Zeit in größerer Zahl in der Türkei präsent waren, an diesem Genozid initiativ mitgewirkt hätten, dann, glaube ich, überschätzt man wohl ihre Rolle und auch ihre realen Einflussmöglichkeiten.
Die historische Forschung hat inzwischen hinreichend belegt, dass der Völkermord an den Armeniern kein spontanes Ereignis war, sondern systematisch vorbereitet wurde. Es gab einen Plan innerhalb von Kreisen des jungtürkischen Regimes.
Mitte März 1915 wurde auf einer Sitzung des inneren Kreises des Zentralkomitees der herrschenden radikalnationalistischen jungtürkischen Partei die Devise ausgegeben, dass der Bekämpfung des „inneren Feindes“ Priorität zukommen müsse. Nachgewiesen sind spezielle parteigebundene Sondereinheiten oder Einsatzgruppen, deren Bestimmung es war, Armenier gezielt und in großer Zahl zu ermorden.
Wer hat diese Einheiten angeführt und koordiniert?
Bahaeddin Schakir, ein Arzt und radikaler Ideologe, der viel zur Etablierung des ersten Ein-Parteien-Systems der europäischen Geschichte im Jahre 1913 beigetragen hatte. Später wurde er eine Art Heinrich Himmler der Jungtürken und profilierte sich mithilfe der besagten Einsatzgruppen. Schakirs Privatpapiere sind heute im Besitz eines türkischen Historikers, der sie an der University of Princeton stufenweise auswertet. Dadurch erhalten wir auch Einblicke darüber, wie schnell und intensiv der extreme Nationalismus der Jungtürken entfesselt wurde und schließlich zu einer genozidalen Gefahr für die armenische Minderheit wurde. Schakir war übrigens einer der führenden Jungtürken, die nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin lebten und dort Anfang der 20er-Jahre bei einer armenischen Vergeltungsaktion erschossen wurden.
Was hat die Armenier in der Türkei zu solch einem Hassobjekt gemacht, dass man sie in großer Zahl loswerden wollte?
Anders als etwa die Haltung der deutschen Nazis gegenüber der jüdischen Minderheit fußten die türkischen Aversionen gegen die Armenier auf keinem geschlossenen Weltbild. Gleichwohl wurden die Armenier, nicht zuletzt aufgrund ihres relativ hohen Bildungsstandes und ihrer wirtschaftlichen Stärke, als eine starke Bedrohung empfunden. Hinzu kamen die kulturellen und religiösen Gegensätze, die man ebenso bedrohlich empfand. Die armenische Minderheit wurde also als eine ernst zu nehmende Gefahr für die kraft Eroberungsrecht herrschende türkische Nation betrachtet, und dieser vermeintlichen Gefahr trachtete man letztendlich mit den radikalen Mitteln einer „Endlösung“ zu begegnen.
Die wie aussehen sollte?
Heute wissen wir, dass statistische Vorgaben entwickelt wurden, die Größe der armenischen Bevölkerung in Kleinasien von 1,7 Millionen Menschen auf rund 200 000 zu reduzieren – auf welche Art und Weise auch immer. Zunächst wurde der Druck auf die Armenier, auszuwandern, stark forciert. Zwischendurch gab es Pläne, alle Armenier über die russische Grenze hinweg zu vertreiben. Das ist dann wieder verworfen worden, und schließlich hat man sich dafür entschieden, möglichst viele Armenier in die Mesopotamische Wüste zu deportieren. Während dieser Transporte wurden insbesondere an den Männern immer wieder in großem Umfang gezielte Massaker verübt. In der Wüste selbst kamen dann oft nur noch ausgemergelte Frauen und Kinder an, die dort ebenfalls ein grausames Ende fanden.
Adolf Hitler hat schon zu Beginn der 1920er-Jahre die jungtürkische Bewegung für ihren rigiden Nationalismus, aber auch die brutale Behandlung ihrer Gegner bewundert. Haben die deutschen Nationalsozialisten am Ende sogar davon „gelernt“?
In der Tat sagte Hitler bereits 1924 vor dem Münchner Volksgerichtshof, die Jungtürken hätten den Geist einer erwachenden Nation in eine „vergiftete Welt“ getragen. Mit „vergiftet“ meinte er eine multi-ethnische und multikulturelle Welt. Hitler bewunderte die „ethnische Säuberung“, die die Jungtürken gegen die Armenier im eigenen Land durchgeführt hatten. Dafür hatte er, wie jüngere Forschungsergebnisse nahelegen, wohl sogar mehr Bewunderung übrig als beispielsweise für den Faschismus von Mussolini und dessen starken Staat.
Gibt es, nach allem, was vorgefallen ist, eine realistische Chance der Aussöhnung zwischen Armeniern und Türken?
Wenn ich mir anschaue, wie detailgetreu und akribisch armenische wie auch türkische Historiker in den letzten Jahren teils noch unbekannte Quellen zu dem damaligen Geschehen studiert und ausgewertet haben, dann stimmt mich das im Prinzip schon hoffnungsvoll. Letztendlich befördern diese Arbeiten ja auch ein Miteinander, wenn auch ein schmerzhaftes. In der Türkei selbst erleben wir verstärkt, dass Intellektuelle, Schriftsteller, Historiker und Künstler sich mit dem Genozid an den Armeniern auseinandersetzen und versuchen, auch unter Schwierigkeiten eine öffentliche Debatte zu initiieren. Das wäre vor zehn oder 20 Jahren kaum denkbar gewesen, und es bleibt abzuwarten, ob dies längerfristig auch seine Wirkungen auf die offizielle Politik haben wird.
Das Gespräch führte Olaf Glöckner
Rolf Hosfeld: „Tod in der Wüste: Der Völkermord an den Armeniern“, CH Beck, Februar 2015; ISBN 978-3-406-67451-8
Rolf Hosfeld (66) ist seit 2011 wissenschaftlicher Leiter des Lepsiushauses in Potsdam. Der Autor und Kulturhistoriker setzt sich seit 2005 vornehmlich mit der Geschichte des Völkermords an den Armeniern auseinander.
Am Lepsiushaus wird derzeit zum Armeniermord im Kontext von Bevölkerungstransfers geforscht und eine vergleichende Perspektive zu Genoziden des 20. Jahrhunderts erarbeitet.
Wissenschaftlich arbeitet das Lepsiushaus mit der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam und mit dem Moses Mendelssohn Zentrum zusammen. Zuletzt hat es mit dem Deutschen Historischen Museum eine Konferenz über das Deutsche Reich und den Armenier-Genozid
initiiiert. PNN
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: