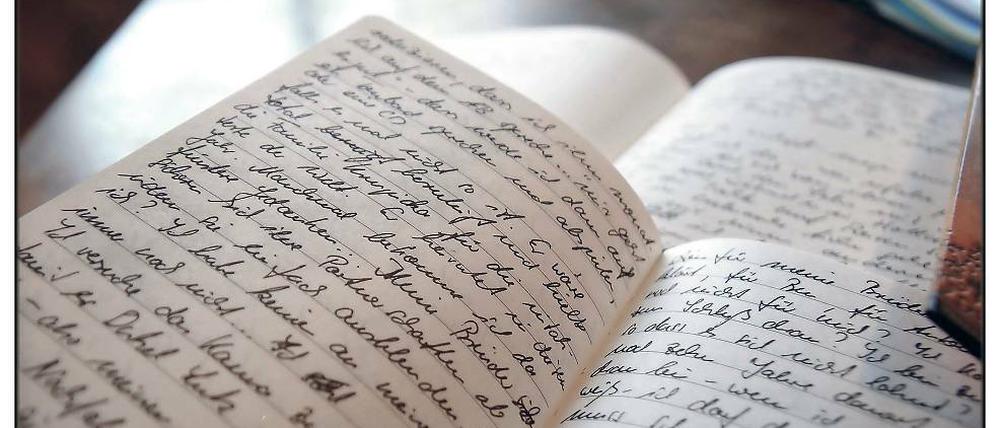
© Kitty Kleist-Heinrich
Kultur: „Sprachlosigkeit kann sehr poetisch sein“
Abbas Khider, der am Donnerstag in Potsdam liest, über Schreiben als Heimat und die Schrift als Held
Stand:
Herr Khider, was bedeutet Heimat für Sie?
In meinem Leben hat sich dieser Begriff ständig geändert. Aber wenn ich aktuell an Heimat denke, dann denke ich an meine Geschichte. Denn Heimat hat ja immer mit der eigenen Geschichte zu tun, mit den Erfahrungen und Erinnerungen, Freundschaften und Beziehungen. Und manchmal, da kann Heimat einfach alles sein, auch ein schöner Abend, ein Glas Wein oder das Lächeln eines Kindes. Vielleicht hat diese Sichtweise mit meiner Geschichte zu tun, denn ich habe viele Länder kennengelernt. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, habe davon 20 Jahre im Irak und 20 im Exil verbracht. Somit ist es schwer für mich, Heimat konkret an einen Ort zu binden.
In Ihren Romanen „Der falsche Inder“, „Die Orangen des Präsidenten“ und „Brief in die Auberginenrepublik“, den Sie am morgigen Donnerstag in Potsdam vorstellen, verarbeiten Sie Ihre eigene Geschichte. Ist das Schreiben für Sie eine Art Bewahren von Heimat?
Das ist bei mir wie bei einem Maler. Für den ist ein Gemälde mehr als nur ein Werk. Und wenn man so etwas schafft, ein Gemälde oder ein Buch, dann ist das auch ein Stück Heimat. Für mich ist die Literatur eine große Heimat. Sie ist meine große Liebe, die ich für das Wichtigste in meinem Leben halte. In meinen drei Romanen steckt natürlich sehr viel von meiner eigenen Geschichte, aber auch viel von meiner Zeit und den Geschichten von Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. In der Literatur kann man eine poetische Heimat finden, ja erfinden und sich ganz frei in ihr bewegen.
Wie haben Sie Ihre große Liebe, die Literatur, gefunden?
Durch das Lesen. Ich komme aus einer armen Familie, wir sind neun Geschwister und meine Eltern waren Analphabeten. Aber ich habe trotzdem die Literatur entdeckt. Das war schon als Junge meine große Leidenschaft. Damals habe ich festgestellt, dass man durch das Lesen unglaublich mit der ganzen Welt verbunden sein kann. Da fühlte ich mich mit Lorca in Spanien, mit Puschkin in Russland und mit Victor Hugo und „Die Elenden“ in Frankreich, mit ihren Ideen, Geschichten und den Menschen, von denen sie erzählen. So war ich in der ganzen Welt unterwegs, obwohl ich an einem kleinen Ort irgendwo in Bagdad hockte. So habe ich sehr viel Zeit verbracht und bin dann irgendwann auf die verrückte Idee gekommen, selbst Literatur zu schreiben.
Sie waren 19 Jahre alt, als Sie unter Saddam Hussein für zwei Jahre ins Gefängnis kamen. Zwei Jahre in einem Kellerverlies. Haben Ihnen da Geschichten geholfen, zu überleben?
Im Gefängnis waren Bücher, Bleistifte und Hefte verboten. Das Einzige, das ich lesen konnte, stand an den Wänden. Also alles das, was die anderen da verewigt hatten. Das war nicht viel in einer 20 Quadratmeter großen Zelle, die sich 20 Männer teilen mussten. Aber wir haben miteinander gesprochen, uns von unserem Leben erzählt. Das hat uns sehr stark miteinander verbunden, das Wissen um die Schicksale der anderen Männer. Manche von ihnen saßen schon seit Jahren im Gefängnis und wollten erzählen, von ihren Erfahrungen, ihren Träumen. Und sie wollten sich auch erzählen lassen. Aber es war oft sehr schwierig, denn der ständige Hunger, die Folter und Gewalt spielten eine sehr große Rolle. Trotzdem, wir hatten ja sonst nichts anderes, wir konnten uns nur unsere Geschichten erzählen.
In „Brief in die Auberginenrepublik“ fehlt dem ehemaligen Studenten Salim, der aus dem Irak geflohen ist, dieses Gegenüber, dem er sich so gerne mitteilen möchte. Nicht einmal einen einfachen Brief kann er an seine Geliebte Samia schreiben, ohne sie in Gefahr zu bringen. Er ist zwar in Sicherheit, muss aber sprachlos bleiben.
Ja, und manchmal kann diese Sprachlosigkeit sehr poetisch sein. In dem Roman, der Ende der 90er-Jahre spielt, habe ich keinen Helden in den Vordergrund gestellt, sondern einen Brief. So habe ich versucht, die Schrift zu einem Helden in diesem Roman zu machen. Und trotzdem bleibt da die Sprachlosigkeit. Eine Sprachlosigkeit als eine Art Oberbegriff für das gesamte Leben im Exil. Ich habe versucht, alles um diese Schrift, diesen Brief herum darzustellen. Wie kommt es dazu, dass man nicht einmal einen einfachen Brief verschicken kann? Wie lebt man als Exilant mit diesem Wissen? Wie träumen Menschen im Exil, die ihre Familien verloren haben. Welche Rolle spielt die Politik und diese verschiedenen, so fremden Länder im Leben dieser Menschen? Und ich frage nach den Geschäftsideen, die manche von ihnen aus diesem Leid entwickeln.
Also der Versuch Salims, illegal und für viel Geld den gewünschten Brief endlich Samia zukommen zu lassen.
Das müssen wir uns einmal vorstellen, dass es vor 14 Jahren noch möglich war, jemandem nicht schreiben, ihn nicht erreichen zu können. Heute haben wir Internet, schreiben uns Mails, gibt es viele Möglichkeiten, Kontakt herzustellen. Doch damals war ein Brief ein Verbrechen. Wie fremd und fern das heute wirkt. Das habe ich versucht, in diesem Roman darzustellen. Am Ende aber bleibt nur eine Wahrheit: Sprachlosigkeit kann sehr poetisch sein.
Aber ist nicht vielleicht die Hoffnung, dass diese Sprachlosigkeit doch noch durchbrochen werden kann, auch eine Wahrheit?
Solange der Mensch weiterleben will, gibt es etwas, nach dem er strebt, auf das er hofft. Und selbst diese Hoffnung wird von anderen missbraucht, wird zum Geschäft, mit dem sich viel Geld verdienen lässt. Wie in dem Roman der Brief von Salim. Natürlich steckt da die ganze Hoffnung drin. Aber das ist es nicht allein, da gibt es so viele Faktoren. Es ist wie mit dem Satz, „Ich bin ein freier Mensch“, den wir so oft benutzen. Aber wer von uns ist frei? Mein Gott, hier wird sogar die Kanzlerin überwacht. Und wir reden von Freiheit.
Ist Hoffnung dann wie die Freiheit immer nur eine Illusion?
Ja, natürlich. Aber was wären wir ohne Illusionen? Nur traurige Gestalten. Wir brauchen alle Illusionen in unserem Leben. Wie jede dieser Figuren in meinem Roman. Da gibt es das Kapitel über den irakischen Lastwagenfahrer, der regelmäßig zwischen Amman und Bagdad pendelt. Der hat seinen Sohn im Krieg verloren. Aber dann bekommt seine Tochter einen Sohn und der bekommt den Namen seines verstorbenen Onkels. Und der Lastwagenfahrer, der so lange traurig war, fühlt sich auf einmal so, als sei sein Sohn wieder neu geboren. Jetzt beeilt er sich ständig, um nach Hause zu kommen und seinen kleinen Enkel zu sehen. Jahrelang war er am Boden zerstört, weil sein Sohn, der Medizin studiert hatte und Arzt geworden war, im Krieg gefallen ist. Im Grunde hatte er alle Hoffnungen verloren. Und dann kommt nur ein Kind, das den Namen seines Sohnes trägt, und gibt ihm wieder Hoffnung, weiterzuleben. Illusionen sind so wichtig in unserem Leben.
Das Gespräch führte Dirk Becker
Abbas Khider liest am morgigen Donnerstag um 20 Uhr im Viktoriagarten in der Geschwister-Scholl-Straße 10 aus seinem Roman „Brief in die Auberginenrepublik“ (Edition Nautilus, 18 Euro). Der Eintritt kostet 6, ermäßigt 4 Euro
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: