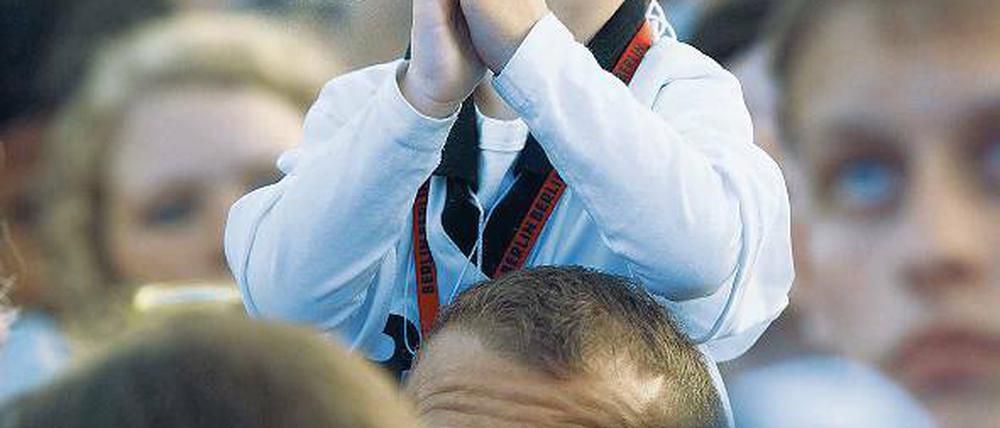
© Archiv
Kultur: Wie kommt das Schöne in den Text
Die Schriftstellerin Antje Rávic Strubel über ihren heftigen Widerwillen gegen Fußball
Stand:
Es gab eine Zeit, in der man folgenden Satz formulieren konnte: Ich interessiere mich für Fußball. Es gab eine Zeit, in der diese Formulierung nichts weiter bedeutete als eine Aussage über den eigenen Lieblingssport, ein sportliches Hobby. Wie Federballspielen. Wie Schach. Ich interessierte mich immer ein bisschen mehr für das Spielen als für das Zugucken, immer etwas stärker dafür, selbst Torschützin zu sein, als über Torschützen zu reden, aber auch ich verbrachte einst einige Abende gebannt vor dem Bildschirm, auf dem vor allem viel Grün zu sehen war. Fußballgucken bedeutete viel Geduld aufzubringen gegen sehr viel Lärm. Lärm, den die Kommentatoren machten. Lärm der Zuschauer im Stadion, der durch die Übertragung verzerrt wurde, aber nicht störte, weil ich den Ton leiser drehen konnte, während ich mir Techniken abguckte für das eigene Spiel.
Ich sage „einst“, weil „einst“ ein Wort ist, das in eine beinahe märchenhafte Vergangenheit zurückweist. Einst war ich ein Kind. Dieses Kindsein kommt mir so phantastisch vor wie der Gedanke, dass ich es war, die das sagte: Ich interessiere mich für Fußball. Aber in dieser phantastischen Ferne sind ein paar Namen auszumachen, die mir beweisen, dass es sich nicht um einen Irrtum handelt. Sie verankern diese Formulierung in dem, was wir gewöhnlich Wirklichkeit nennen. Rummenigge ist so ein Name. Lothar Matthäus. Ich erinnere mich sogar daran, dass ich den Haarschnitt von Lothar Matthäus nicht mochte. Sein Haar sah aus wie ein über den Kopf gestülptes Bastkörbchen. Fußballgucken bedeutete, Gesprächsstoff zu haben für den nächsten Schultag. Es bedeutete, mitreden zu können. Es bedeutete auch, mithilfe der eigenen Begeisterung im Westen zu sein. Die Männer in den schwarzen Hosen und den weißen Shirts, die da über den Rasen rannten, gehörten nicht zur National-Elf der DDR. Ich feuerte die Mannschaft eines fremden Landes an. Aber Begeisterung hat nie Probleme, Grenzen zu überwinden.
Wenn es heute um Fußball geht, sind die identifikatorischen Fragen weniger komplex. Ausgenommen vielleicht die Nationalspieler, die aus der Türkei oder aus Chile eingekauft werden und im Trikot der deutschen Mannschaft Tore für Deutschland schießen. Aber sie werden so gut bezahlt, dass es leicht ist, die Komplexität durch ein hohes Einkommen zu ersetzen. Die Fähnchen, die hier an den Autos flattern, sind alle gleich. Auch die Socken, über Rückspiegel gestülpt, leuchten einheitlich schwarz-rot-gold. Wo gewöhnlich Menschen mit unterschiedlichsten Ansichten, Erlebnissen und Träumen im Auto sitzen, scheint die Flagge sie alle auf einen Traum herunterzuschrumpfen: dass diese Fahne am Ende auf dem obersten Treppchen weht.
Neulich war ich im Maison du Chocolate im Holländerviertel. Es war acht Uhr abends am Wochenende, ein milder, etwas windiger Junitag, verhalten sonnig, das perfekte Wetter, um nach einem Spaziergang im Park unter Sonnenschirmen auf dem Trottoir einen Weißwein zu trinken. Die kopfsteingepflasterten Straßen lagen da wie nach einer Evakuierung. Nichts regte sich zwischen den roten Häusern mit den weißen Ziergiebeln. Das Restaurant sah aus, als hätte es bereits geschlossen. Kein Platz war besetzt. Die Bedienung faltete Servietten für den nächsten Tag. Im Hinterzimmer hörte man das Brausen des Lärms, das aus einem Fernseher drang. Sonst nichts. Eine Stadt wie gelähmt.
Eine Stadt regloser Köpfe. Regloser Körper.
Im Maison du Chocolate, deren Köche und Kellner im Hinterzimmer vor dem Fernseher saßen, sagte die Bedienung: „Gönnen Sie unseren Jungs den Spaß.“
Nie habe ich in Potsdams Innenstadt am frühen Abend in solcher Ruhe einen Weißwein getrunken. Ganz klar: Ich gehöre nicht dazu. Ich habe längst aufgehört, den Satz aus meiner Kindheit auch nur zu denken. Er hat sich ins Gegenteil verkehrt. Ich verspüre, sobald es um Fußball geht, einen heftigen Widerwillen. Fußballgucken ist keine freiwillige Sache mehr. Es verhält sich eher so wie bei „Matrix“. Vor einigen Jahren lief dieser Dreiteiler über eine dystopische Welt in den Kinos. Die Menschen waren an fühlende Maschinen-Wesen angeschlossen, die ihnen Körperwärme und geistige Energie abzapften. Dass sie als reglose Energieressource dienten, war den Menschen nicht bewusst. Sie glaubten, sie seien beweglich, unterwegs in ihrer gewohnten Wirklichkeit, die allerdings eine von den Maschinen simulierte war.
Später kam ich an der „Zillestube“ vorbei, die ein Freund schmeichelnd Fusion-Lokal nennt: Fusion aus brandenburgisch-preußischer Heimatliebe, Balkandekoration und aufgetauter Tiefkühlpizza. Auf einer Tafel stand mit Kreide: „Die EM- Alle Spiele Live und in HD-Qualität!“ Am Ende der dunklen Hausdurchfahrt waren Köpfe zu sehen, hochgereckte Arme vor einer Leinwand mit viel Grün. Eine Masse dampfender Leiber, die Lärm absonderte, ohrenbetäubend und wie aus einer Röhre herausschwappend, bevor er wenige Meter weiter verebbte. Der Lärm suggerierte Bewegung. Er erweckte den Anschein von Lebendigkeit, wo sich im Einzelnen nichts tat. Einzelnes war eingeschmolzen, individuelle Stimmen versackten in einem einzigen großen Laut, der die Körper in der Menge erfasst hatte, sie mit einem Fieber so vollkommen besetzte, dass sich niemand daran erinnerte, wie festgeschweißt sie dort saßen, auf Holzplankenstühlen, hin und wieder hochgerissen von der Welle anschwellenden Gebrauses und zurückgeworfen auf den Stuhl, ohne eigenes Zutun, ohne Beteiligung der Muskeln, ohne Gedanken, außer dem, der Welle zu folgen, mitzuschwappen in der ewigen Bewegung aus diffuser Angst und Hoffnung, beirrt von den Bildern auf der Leinwand; die perfekte Simulation von Wirklichkeit, mit der ein unfreiwilliger und ungeheurer Energieverlust einherging, der vergeblich und darum immer wieder neu mit Bier ausgeglichen wurde. Würden die Bilder auf einmal verschwinden, käme das dem freien Fall der Menge gleich, ein Absturz in den Schmerz, den ein regloser Körper, wird er wiederbelebt, produziert; steife Gelenke, verspannte Muskeln, Orientierungslosigkeit. Aber die Bilder verschwinden selten. Sie lassen nicht nach. Sie werden wiederholt, Zeitlupen ziehen sie in die Länge, überbrücken Halbzeiten und Spielpausen, bestimmen Talkshows und die Werbung, sie werden solange kommentiert und analysiert, bis die Analyse nur noch einen Satz ausmacht, der in Endlosschleife mit den verschiedensten Gesichtern unterlegt wird: „Wir können mit dem Spiel sehr zufrieden sein.“
Das können „wir“ wirklich. Schließlich kann jeder über Fußball reden. Jedes Kind begreift dieses Spiel. Anhand einer einzigen Regel wird entschieden, wer dazu gehört und wer nicht. Die Abseitsregel ist nicht schwieriger als Vorfahrtsregeln im Straßenverkehr. Aber sie wird ungeheuer aufgebauscht, um das Dazugehören attraktiver zu machen. Früher konnte sich an dieser Stelle Widerstand formieren. In der Abneigung, die Abseitsregel auch nur zu kennen, äußerte sich Resistenz gegen eine männlich dominierte Sportart. Mittlerweile sorgt die Übermacht des Männerfußballs dafür, daß Verweigerung beinahe unmöglich geworden ist. Kein Veranstaltungskalender mehr, der nicht auf „wichtige Spiele“ abgestimmt werden muss. Keine Kanzlerin mehr, die „unseren Jungs“ nicht Glück wünscht. Keine Firma, keine Partei, keine kulturelle Institution mehr, die sich nicht dem Fußball anbiedert. Keine Nachrichtensendung, die ohne eine Meldung zum gebrochenen Zehennagel eines Mittelfeldspielers oder eines Trainerwechsels bei einem Drittligisten auskommt. Selbst der Wetterbericht wird als gute oder schlechte Nachricht für ein Spiel ausgelegt. Früher sprach man im Juni von Badewetter oder Sommerwetter. Heute sagt man „Fußballwetter“.
Das ist es, was ich meinte: Fußball ist keine freiwillige Sache mehr. Er ist zu einer Evakuierung des Denkens geworden. Und sein wirksamster Zwang besteht darin, dass man nicht die einzig Zurückbleibende nach einer solchen Evakuierung sein möchte.
Ich weiß nicht, wie das Schöne hier in den Text kommen soll.
Ich könnte das Fenster aufmachen, wenn gerade kein Spiel ist. Es könnte sein, dass in den Halbzeitpausen die Musiker auf dem Böhmischen Weberfest ihr Repertoire aus Klezmer und Tango abspielen, Musik, die Sehnsucht entzünden würde, hätte sie mehr Zeit. Es könnte sein, dass in der Stille zwischen zwei Toren im Hans Otto Theater eine außergewöhnliche Inszenierung unterbesucht über die Bühne geht, oder die fabrik eine international gerühmte Tanzperformance für ein paar versprengte Zurückgebliebene abhält. Es könnte sein, dass ein Kunst-Mäzen die Stimme erhebt und seine Botschaft schockierend genug ist, um den Lärm kurzzeitig mit Demos zu übertönen. Die Chancen, in einem falschen Augenblick das Fenster zu öffnen, werden allerdings in rasender Eile größer.
Die Schriftstellerin Antje Rávic Strubel schreibt an dieser Stelle alle drei Monate nicht nur zum Thema Potsdam
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: