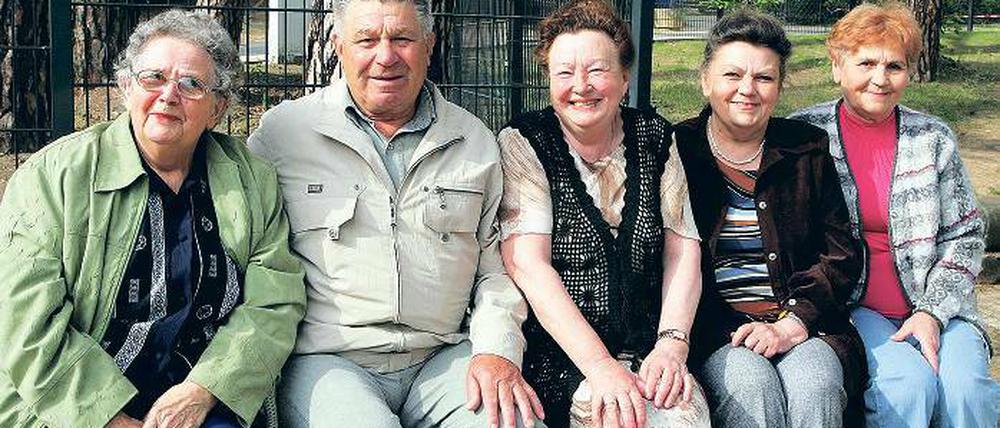
© Manfred Thomas
Von Thomas Lähns: Das gelbe „P“ hat überdauert
Frühere Zwangsarbeiter kehren nach 65 Jahren zurück in die Mittelmark – mit zwiespältigen Gefühlen
Stand:
Michendorf - Es war kein einfaches Wiedersehen: Nach 65 Jahren ist Eugeny Harachka in die Mittelmark zurückgekehrt. „Ich habe alles erkannt: Die Eisenbahngleise, die Havel – und die Silhouette der Fabrik“, berichtet der 82-jährige Weißrusse von einem Besuch in Kirchmöser. Hierher war er 1944 mit seiner Familie aus Minsk verschleppt worden, hier musste er als 14-Jähriger mit anderen Zwangsarbeitern Panzerteile für die Deutschen bauen. Hier starb sein Vater. Davon erfahren hat Harachka erst lange nach der Befreiung durch die Rote Armee, denn als sein Vater unter den unmenschlichen Arbeits- und Wohnbedingungen erkrankt war, wurde er einfach abgeholt.
Eugeny Harachka ist nicht nur hier, um sich auf Spurensuche zu begeben und sich der Trauer zu stellen. Er will jungen Menschen davon berichten, wie es ihm als Jugendlicher ergangen ist. „Es darf nie vergessen werden und es darf nie wieder passieren“, sagt er entschlossen. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat sieben ehemalige Zwangsarbeiter diese Woche nach Michendorf eingeladen. Sie wollen mit Schülern des Wolkenberg-Gymnasiums und der Oberschule ins Gespräch kommen und ihre früheren Einsatzorte besuchen. Ihre Empfindungen sind dabei nicht nur von düsteren Erinnerungen geprägt – in einem Fall gab es sogar ein freudiges Wiedersehen.
Knapp ein Jahr lang musste Aniela Gawlinkowska aus Polen als Haushaltshilfe bei Familie Russe in Michendorf arbeiten. Eine ihrer Aufgaben: Sich um das Kind kümmern. Ihr sei es nicht schlecht ergangen, sagt sie: „Die Deutschen haben mich gut behandelt. Ich hatte zu Essen und ein Dach über dem Kopf.“ Bis heute hält sie Kontakt zu ihrer früheren Pflegetochter – Besuche inklusive. Die 85-Jährige erzählt ihre Geschichte aus der Sicht eines Teenagers: „Ich war jung und schön – da denkt man nicht an das Unrecht, sondern lebt von einem Tag auf den anderen.“ Sie muss sogar kichern, als sie erzählt, wie sie sich mit Freundinnen den großen gelben Aufnäher – das „P“ für Pole – von der Jacke abgetrennt hat, um sich ins Kino oder ins Café zu „mogeln“.
Vom „Glück“, in eine anständige Familie geraten zu sein, berichtet Nina Lopatko, die 1944 in Bützow geboren wurde. Ihre weißrussischen Eltern waren Zwangsarbeiter auf dem Bauernhof der Ehlerts, haben sich hier kennen- und liebengelernt. „Alle haben immer an einem Tisch gegessen, Deutsche und Zwangsarbeiter. Und ich wurde sogar von einer Deutschen betreut“, weiß Nina aus Erzählungen ihrer Eltern. Damals hieß sie noch Erna – ein urdeutscher Name, den sie nach der Rückkehr aus Angst vor Repressalien ablegen musste. Sie sei der Einladung nach Brandenburg gefolgt, um das Land zu sehen, in dem sie ihre ersten Schritte gemacht hat.
Es sind zwiespältige Gefühle, die der Besuch in der Mittelmark bei den früheren Zwangsarbeitern auslöst. Obwohl die meisten von ihnen milde an ihre geraubte Kindheit denken und voll des Lobes für den herzlichen Empfang sind, der ihnen hier bereitet wird, hat sie die Vergangenheit nie losgelassen. Aniela Gawlinkowskas Nichte erzählt, dass ihre Tante das gelbe „P“ bis heute aufgehoben hat. Und Galina Gurkova, die 1942 mit ihrer Familie aus Weißrussland erst ins KZ verschleppt und dann als Zwangsarbeiterin auf einem Bauernhof in Michendorf eingesetzt wurde, sagt, dass sie endlich einen Schlussstrich ziehen möchte. Sie will Blumen an der Stelle niederlegen, wo früher ihre Wohnbaracke stand.
Nicht nur in Deutschland wurde lange Zeit über das Unrecht geschwiegen – auch in Osteuropa war es bis vor kurzem ein Tabuthema. „Erst vor fünf Jahren kam Einiges in Bewegung“, sagt Martin Kastranek von der Heinrich-Böll-Stiftung, die dafür die Vorarbeit geleistet hat und heute Begegnungen mit Zeitzeugen ermöglicht. Das Schicksal der Zwangsarbeiter sei aber längst nicht das wichtigste Thema in seiner Heimat, sagt Gurkovas Bruder Vasilij Ulasau. So sei das Interesse der deutschen Schüler schon überraschend. Schmerz empfinde er nicht, wenn er an seine Kindheit in der Michendorfer Baracke denkt. „Es ist viel Zeit vergangen“, sagt er.
Doch nicht alle Wunden heilt die Zeit. Eugeny Harachka, der als einer von Tausenden Zwangsarbeitern in Kirchmöser ausgebeutet wurde, hat das Grab seines Vaters nicht mehr gefunden. 1100 Menschen sind hier in den Kriegsjahren an Unterernährung und Krankheit gestorben. Heute liegen sie in anonymen Gräbern auf einem Ehrenhain des hiesigen Friedhofs. Vor welchem Stein soll er also Abschied nehmen? Eugeny kann nur hoffen, dass seine Worte gehört werden – die der Trauer und die der Mahnung.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: