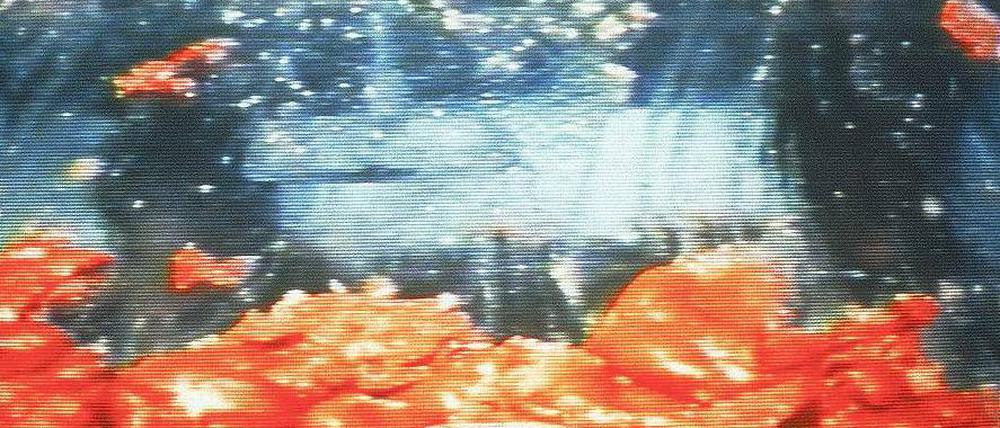
© CINETEXT
Wirtschaft: Angriff der Schrumpeltomaten
Das Europäische Patentamt verhandelt über das Schutzrecht an einer Pflanze. Kritiker warnen vor steigenden Preisen
Stand:
Berlin - Der Zankapfel, um den am Dienstag beim Europäischen Patentamt in München gestritten wurde, ist eine Tomate. Genauer gesagt: eine Schrumpeltomate. Für den Verbraucher klingt das unappetitlich, doch die Züchtung hat einen besonderen Vorteil gegenüber der gemeinen Tomate: Weil sie nur wenig Wasser enthält, eignet sie sich besonders gut, um Ketchup und Saucen herzustellen.
Diese Innovation in der Tomatenzüchtung ließ sich das Landwirtschaftsministerium in Israel 2003 patentieren. Seither beschäftigt die Schrumpeltomate das Europäische Patentamt (EPA). Denn der niederländische Lebensmittelkonzern Unilever, der selbst Tomatensoßen und Ketchup herstellt, will, dass das Patent aufgehoben wird. 2004 erklärte Unilever in seiner Anfechtung, das Zuchtverfahren der Tomate sei „im Wesentlichen biologisch“ und könne deshalb nicht patentiert werden. Der Konzern hatte Erfolg: Das EPA folgte 2010 dieser Rechtsauffassung und entschied, dass konventionelle Züchtungsverfahren nicht patentierbar sind. Bei der konventionellen Züchtung wird – anders als bei Gentechnik – das gesamte Genom von Pflanzen gekreuzt.
Geklärt war der Fall damit nicht. Zwar verlor Israel das Patent auf die Züchtung, nicht aber auf die Schrumpeltomaten selbst. Ob das so bleibt, sollte das Patentamt am Dienstag klären. Doch das EPA setzte die Verhandlung wegen ungeklärter Rechtsfragen aus, teilte ein Sprecher am Abend mit. Nun soll die Große Beschwerdekammer des EPA entscheiden – einen Termin gibt es noch nicht.
Dabei geht es um mehr als nur um Tomaten. Die Verhandlung wirft auch eine Grundsatzfrage auf: Darf man Grundnahrungsmittel patentieren und damit Konzernen oder Behörden die Rechte an Pflanzen und Samen geben, die Menschen zum Überleben brauchen? Umweltschützer, die am Dienstag vor dem EPA demonstrierten, laufen Sturm gegen die Patente. „Es gilt zu verhindern, dass es irgendwann kein Saatgut mehr auf dem Markt gibt, das nicht dem Patentschutz unterliegt“, sagte der Sprecher des Bündnisses „Keine Patente auf Saatgut“, Christoph Then. Rund 100 Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen habe das EPA im letzten Jahrzehnt erteilt, sagt Then. Darunter sind Melonen, Kürbisse und das ebenfalls angefochtene Brokkoli-Patent, zu dem das EPA noch keine Entscheidung verkündet hat. Greenpeace findet, dass nur technische Anwendungen patentierbar sind. „Gene, Pflanzen und Tiere können nicht erfunden, sondern nur entdeckt werden“, heißt es auf der Webseite der Umweltschutzorganisation.
Eigentlich sollen Patente Innovation fördern. „Das Patent schafft ein temporäres Monopol, dass es für Unternehmen lohnenswert macht, in Forschung zu investieren“, sagt Knut Blind, Professor für Innovationsökonomie an der TU Berlin. Es gebe aber auch Patente, die die Märkte nach Ablaufen des Schutzes noch über Jahrzehnte monopolisierten und Wettbewerb verhinderten. „Wir sehen auf einigen Märkten ein Spiel der Großen“, sagt Blind, der auch am Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme in Berlin forscht. Ein Beispiel sei das Geschäft mit gentechnisch veränderten Pflanzen.
Für Konzerne wie Unilever geht es daher um viel Geld. Denn sollte Israel das Tomatenpatent behalten dürfen, könnte es für den Anbau der Schrumpeltomate Lizenzgebühren verlangen oder diesen gar verbieten. „Die Sorge ist, dass die Pflanze zum dominierenden Produkt wird und Bauern und Züchter sie nutzen müssen“, sagt Blind. Damit wären sie abhängig vom Patentinhaber und dessen Preisen. Hilfsorganisationen wie Misereor kritisieren, dass die Patente zu Preisanstiegen in Europa, aber auch in Entwicklungsländern führen.
Gerade für kleinere Firmen könnten steigende Preise zum Problem werden, meint Blind. Der Deutsche Bauernverband drückt das drastischer aus: Patente auf Pflanzen könnten das „Aus für eine lebendige mittelständige Züchtungsbranche“ in Europa bedeuten. Zwar müssten sich Investitionen in Forschung und Züchtung lohnen – Monopole dürfe es aber nicht geben, kritisiert der Verband. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) geht noch weiter. Sie ist gegen Patente auf klassische Zucht und daraus entstehende Pflanzen – „aus ethischen, fachlichen und rechtlichen Gründen“, heißt es auf der Webseite des Ministeriums.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: