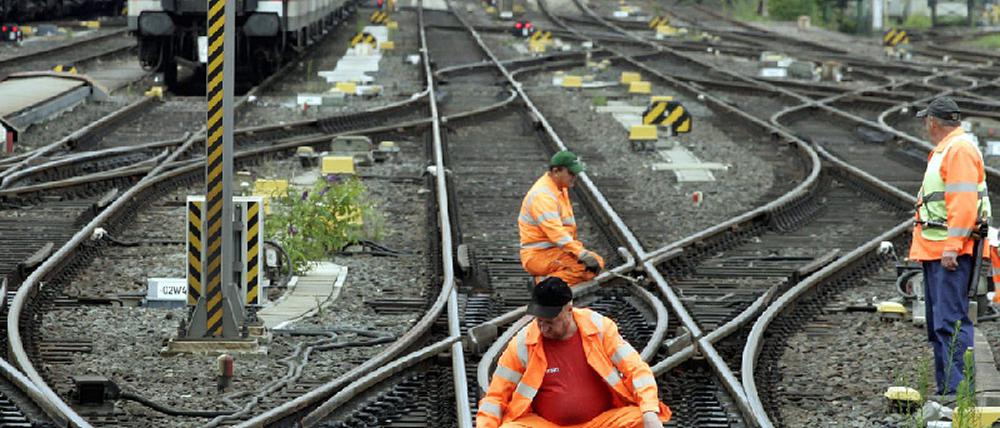
© ddp
Bahn-Privatisierung: "VEB? Nein danke!"
Politik und Management streiten über das beste Modell der Bahn-Privatisierung. Die Deutsche Bahn wendet sich kategorisch gegen das Modell der Volksaktie, das in Teilen der SPD favorisiert wird.
Stand:
Berlin - Finanzvorstand Diethelm Sack sagte am Donnerstag, ihn erinnere das Modell an die „Volkseigenen Betriebe“ aus DDR-Zeiten. Der Vorschlag sieht stimmrechtslose Vorzugsaktien vor, um Großinvestoren vom Einstieg abzuhalten. Doch leichter werde es für die Bahn dadurch nicht, sagte Sack. „Das erhöht den Renditedruck.“ Denn während ein normaler Investor eine Dividende von drei bis vier Prozent erwarte, sehe die Volksaktie eine Garantiedividende von fünf Prozent vor. Zudem werde eine zusätzliche Kapitalrücklage gefordert. Das Modell sei „völlig unausgegoren“ und gefährde das Vertrauen ausländischer Investoren in den Standort Deutschland.
Für Sack geht es derzeit um eine einzige Grundsatzfrage: „Will ich die Bahn, die unternehmerisch tätig ist, oder will ich zurück zur alten Bundesbahn?“ Die Bahn strebe „einen ganz normalen Börsengang“ an und werde sich auch um Kleinanleger bemühen. Ferner wolle man Belegschaftsaktien mit einem Preisnachlass und einer Haltefrist von sechs Jahren ausgeben. Die Bahn beschäftigt 230 000 Mitarbeiter und ist an ihrem Berliner Sitz mit rund 20 000 Beschäftigten der mit Abstand größte Arbeitgeber.
Sack wies Behauptungen zurück, das Schienennetz sei eigentlich hunderte Milliarden Euro wert und werde nun verschleudert. „Das ist im Zusammenhang mit der Teilprivatisierung der absolute Schwachsinn.“ Der Wiederbeschaffungswert sei nicht annähernd der Preis, den Anleger bereit zu zahlen seien. Insbesondere der Berliner Finanzsenator und frühere Bahn-Manager Thilo Sarrazin (SPD) heize die Debatte mit falschen Fakten an. Sack warf ihm „übelste Gaukelei“ vor und sprach von der „Sarrazin’schen Märchenstunde“. So stünden die Grundstücke, auf denen die Schienen lägen, nicht für eine andere Verwertung zur Verfügung und seien daher auch nicht mit ortsüblichen Preisen zu bewerten.
Sarrazin wandte sich am Donnerstag erneut gegen die Privatisierungspläne. Behielte die Bahn das Netz, wäre sie „moralisch und funktional“ überfordert, Wettbewerbern auf der Schiene die gleichen Chancen einzuräumen. Es komme ja auch niemand auf die Idee, Landerechte auf Flughäfen wie in Frankfurt am Main durch die Lufthansa verteilen zu lassen. Mehreren Ländern warf Sarrazin vor, sie ließen sich ihre Zustimmung erkaufen: Baden-Württemberg etwa durch das Milliardenprojekt „Stuttgart 21“ oder Bayern durch den Bau der Transrapidstrecke zum Münchner Flughafen. Die Ausgaben des Bundes für diese Projekte seien höher als die erwarteten Einnahmen aus der Bahn-Privatisierung.
Mehrere Länder stellen die Grundsatzentscheidung infrage, die Bahn samt Schienen zu privatisieren. „Der jetzt vorliegende Vorschlag der Bundesregierung ist nicht zukunftsorientiert“, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Reinhold Dellmann (SPD) dieser Zeitung. „Nach meiner Überzeugung muss das Schienennetz komplett bei der öffentlichen Hand bleiben, denn hier geht es um die Mobilität als staatliche Daseinsvorsorge.“ Diese Aufgabe dürfe nicht kurzfristigen Kapitalmarktinteressen geopfert werden.
Dellmanns hessischer Amtskollege Alois Rhiel (CDU) teilt diese Kritik. „Ich verlange eine klare Trennung von Netz und Betrieb.“ Bei dem bisherigen Konzept der Bundesregierung käme „eine ungeheure Belastung für die öffentlichen Haushalte“ heraus, sagte der Minister dem Tagesspiegel – und verwies darauf, dass die Länder als Besteller von Regionalverbindungen zwei Drittel der Gebühren für die Nutzung des Schienennetzes zahlen. „Das ist keine Reform wie jede andere, sie ist irreversibel. Die Chancen auf bessere Angebote von neuen Anbietern gehen kaputt“, befürchtet Rhiel. Doch könne die Volksaktien-Debatte helfen, das Privatisierungsmodell des Bundes zu verhindern. In der nächsten Legislaturperiode könne man dann den richtigen Weg einschlagen. Sack und sein Vorstandskollege Otto Wiesheu, ehemals bayerischer Verkehrsminister, nannten die Sorgen der Länder unbegründet. Die Ertragskraft des Nahverkehrs sei hoch – ohnehin dürfe die Bahn keine Strecken stilllegen: Darüber entscheide der Bund nach Rücksprache mit den Ländern.
Iris Henseler-Unger, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, sieht durchaus Möglichkeiten, auch bei einer privatisierten Bahn, die das Netz unter dem Konzerndach behält, für ausreichenden Wettbewerb zu sorgen. Auf einer Veranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV), sagte sie am Mittwochabend, die Regulierung müsse umso schlagkräftiger sein, je weniger strikt die Trennung von Netz und Betrieb sei. Zudem müssten Preisobergrenzen festgelegt werden. „Dass die Gefahr ungerechtfertigter Trassenpreise nicht nur abstrakt ist, wird aus den Ankündigungen der DB, den Netzbereich künftig zu einem deutlichen Gewinn zu führen, offensichtlich.“
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: