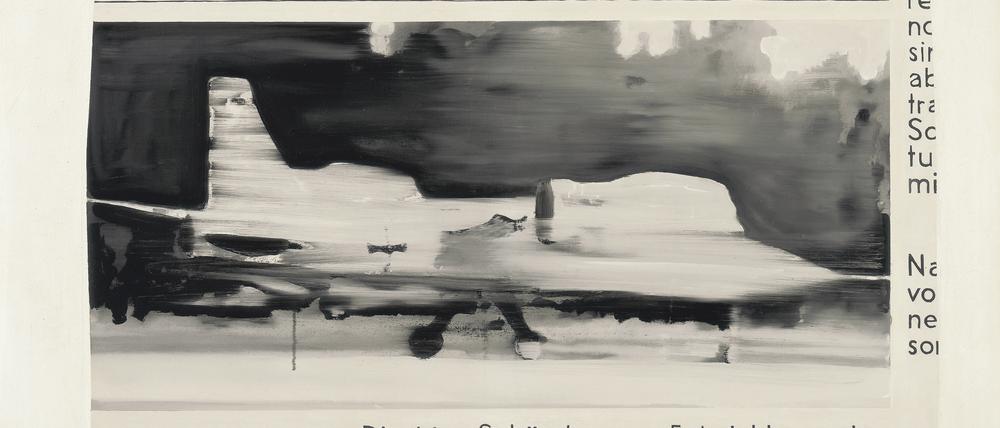
© Gerhard Richter 2024 (0028)
Gerhard Richter im Düsseldorfer Museum Kunstpalast: Rheinisches Heimspiel
Das Düsseldorfer Museum Kunstpalast feiert mit den „Verborgenen Schätzen“ den Weltstar und die kunstsinnige Region mit ihren vielen Sammlern gleich mit.
Stand:
Draußen stehen sie Schlange, und das geht seit Wochen schon so. Die Ausstellung „Gerhard Richter. Verborgene Schätze“ hat dem Düsseldorf Museum Kunstpalast einen Publikumserfolg beschert. Mit ihr feiert das Rheinland seinen berühmtesten Maler, der seit vielen Jahren die ungeschlagene Nummer Eins internationaler Künstler-Rankings ist. Seine Auktionsergebnisse rangieren im Millionenbereich. Zugleich feiert das Rheinland sich selbst, denn die Ausstellung zeigt 120 Werke aus rund fünfzig rheinischen Privatsammlungen.
Sie zelebriert die Region als künstlerischen Nährboden für den knapp 93-jährigen Weltstar, der 1961 aus der DDR in den Westen übersiedelte. Am Rhein fand er eine aufgeschlossene Käuferschaft und eine für seine Hakenschläge empfängliche Museumslandschaft vor. Wer nach einer gewissen Wartezeit vor der Museumstür in die Ausstellung gelangt ist, erlebt prompt stolz miteintretende Besucher, die offenbar „ihr“ Bild in Augenschein nehmen wollen – oder das von Freunden und Nachbarn.
„Verborgene Schätze“ ist ein Heimspiel. Die ebenso einfache wie geniale Ausstellungsidee entstand in Coronazeiten auf der Suche nach einem Konzept mit kürzeren Transportwegen. Ein Selbstläufer kam dabei heraus. Die Leihgeber sollen sich regelrecht gedrängelt haben, um dabei sein zu dürfen, auch wenn die meisten hinterher anonym blieben – man kennt sich ohnehin.

© Gerhard Richter 2024 (0041)
Der schöne Titel „Verborgene Schätze“ behält damit seinen Sinn. Viele der präsentierten Werke sind zum ersten Mal in einer Ausstellung zu sehen und verschwinden anschließend wieder aus der Öffentlichkeit. Ihre hohe Wertschätzung lässt sich an den teils prunkenden Rahmen, monströsen Plexiglas-Hauben ablesen und manches Mal auch an abgeschabten Ecken, wenn der Schatz zu nahe am Herzen hängt.
Die Ausstellung gibt einen Überblick über das vielseitige Schaffen des in Köln lebenden Künstlers von den 1960ern bis exakt 2017. In dem Jahr stellte Richter wegen der körperlichen Anstrengung die Produktion seiner mit großen schweren Rakeln gemalten abstrakten Bilder ein. Heute malt der Künstler mit Öl nur noch collagierend auf Postkartengroße Fotografien oder zeichnet.

© David Pinzer
Der Düsseldorfer Parcours beginnt mit einem monumentalen Fensterbild von 1968 aus dem Besitz des Museums selbst, das Richters permanenten Wechsel zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion thematisiert. Die weißen Rahmen des dargestellten Fensters und dessen Schatten vor grauem Grund könnten ebenso gut reine Flächen sein.
Die von Kurator Markus Heinzelmann eingerichtete Bestandsaufnahme endet mit den letzten beiden Großformaten, die Richters Studio verließen und immer noch Energie versprühen: Ein freches Hellgrün wischt über die dunkle Fläche, ein vorwitziges Pink schiebt sich vor. Wie immer ist als zusätzliche Information pedantisch die Werkszahl im Titel genannt: „Abstraktes Bild (950-1)“ und „Abstraktes Bild (950-2)“. Richter hat stets genau Buch geführt, so dass trotz des Temperaments seiner abstrakten Ausbrüche Berechnung spürbar bleibt.

© Gerhard Richter 2024 (23042024), MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher, Foto Olaf Bergmann, Witten, VG Bildkunst Bonn 2025
Überraschungen sind in der Ausstellung also keine zu erleben, sie folgt wie die rheinischen Sammler getreulich Richters Wechselfällen: von den nach Fotografien entstandenen verwischten Gemälden zu den Grauen Bildern, von den Landschaften zu den Farbmustertafeln, von den „weichen Abstraktionen“ zum herzigen Porträt seines im Kinderstühlchen sitzenden Sohns und einem Blumen-Stillleben. In den 1980er Jahren mussten die meisten Privatsammler passen, als der Siegeszug des Künstlers in den Vereinigten Staaten begann und sich die Preise in die Höhe schraubten.
Wer an Richter denkt, hat auch seinen Stammheim-Zyklus und die Birkenau-Bilder im Sinn, denkt den politischen Künstler mit, als welcher er gleichwohl nie gesehen werden wollte. In Düsseldorf fehlt seine Bearbeitung deutscher Vergangenheit fast gänzlich, bis auf das nach Karl Schwärzler benannte Gemälde aus dem Jahr 1964, das einen Jagdbomber zeigt. Der Titel „Schärzler“ spielt auf den Direktor der Heinkel-Flugzeugwerke an, die während des Nationalsozialismus Zwangsarbeiter aus Konzentrationslagern für sich schuften ließen. Das weggelassene „w“ im Namen des Chefkonstrukteurs macht einen bitterbösen Scherz aus dem Gedächtnisschwund der Deutschen.
Sanfte Wolken und widerborstiges Grau
Bei Richter besteht alles gleichberechtigt nebeneinander: die an die Romantiker erinnernden sanften Wolkengebirge ebenso wie die widerborstigen grauen Bilder. Auf sie stieß der Künstler, als er Mitte der 1960er Jahre auf der Suche nach neuen Motiven die Leinwand damit vermalte. „Mit der Zeit (…) bemerkte ich Qualitätsunterschiede zwischen den Grauflächen und auch, dass diese nichts von der destruktiven Motivation zeigten. Die Bilder fingen an, mich zu belehren“, hat er später die Anfänge dieser Serie erklärt.
„Meine Bilder sind klüger als ich“, lautet ein anderes Bonmot von ihm. In der Düsseldorfer Ausstellung steht man staunend davor, in wie viele Richtungen sie den Maler führten, der vor allem seine künstlerische Freiheit wollte und dem doch viel mehr gelang: eine ganze Gattung neu zur Blüte zu bringen.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: