NSA-Aufklärer und Gurlitt-Porträt vorn.
Cornelius Gurlitt

Cornelius Gurlitt hat seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermacht. Dort weckt sie ambivalente Gefühle, denn die mit dem Erbe verbundenen Verpflichtungen sind hoch. Zugleich entwickelt Bayern neue Begehrlichkeiten. Und der Londoner Museumschef Roth sagt: Die Sammlung passt in kein Kunstmuseum.

Der am Dienstag verstorbene Kunsthändler Cornelius Gurlitt hat seine Bilder dem Berner Kunstmuseum vererbt. Was bedeutet das für die Sammlung?
Cornelius Gurlitt hat testamentarisch verfügt, dass seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern in der Schweiz vererbt wird. Warum gehen die Bilder gerade dort hin?

Das Auftauchen der Bilderkollektion von Cornelius Gurlitt war eine Sensation - und hat die Kunstwelt umgekrempelt. Jetzt ist der 81-Jährige Sammler an einem Herzleiden gestorben.

Der Kunstsammler Cornelius Gurlitt ist mit 81 Jahren gestorben. Die Beschlagnahme von hunderten seiner Kunstwerke löste eine Debatte um Raubkunst im Dritten Reich aus.

Die Untersuchung der unter Raubkunstverdacht stehenden Gemälde aus der Gurlitt-Sammlung ist wichtig - vor allem für mögliche Erben. Doch sollte es dabei fair zugehen. Auch für Cornelius Gurlitt.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hebt die Beschlagnahmung der Gurlitt-Sammlung auf. Unbelastete Bilder erhält der Kunsthändlersohn zurück, Raubkunst will er restituieren. Und in Berlin gibt es womöglich einen neuen Raubkunst-Fall.

Neues Buch: Ex-Kulturstaatsminister Michael Naumann und Provenienzforscher Stefan Koldehoff streiten über Gurlitt und die Folgen.
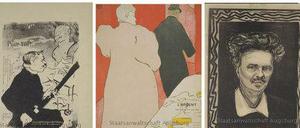
Der Sohn des NS-Kunsthändlers bekommt seine Bilder zurück – und die Taskforce hat ein Jahr Zeit, die Herkunft jener Werke zu erforschen, die unter Raubkunst-Verdacht stehen.

Je ferner die Nazizeit rückt - desto lieber debattieren wir über den Umgang mit ihr. Im Fall Gurlitt läuft dabei allerdings einiges schief.

Ein Quartett von bevorzugten Händlern verkaufte für die Nazis beschlagnahmte Kunst. Jeder ging dabei höchst unterschiedlich zu Werke.

Die Augsburger Staatsanwaltschaft gibt grünes Licht: Das erstes Bild aus dem Schwabinger Gurlitt-Fund kann restituiert werden. Und die erste Sichtung der Schätze in Salzburger Konvolut ergibt: Diese Werke sind womöglich noch kostbarer.

Neue Etappe im scheinbar endlosen Fall Gurlitt: Der Kunstsammler will Bilder an die Erben jüdischer Kunsthändler zurückgeben. Und die Staatsanwaltschaft Augsburg will das erste Restitutionsbild, einen Matisse, auch freigeben.

Eine Arte-Doku über den seltsamen Herrn Gurlitt, der weit über 1000 Kunstwerken fast ein halbes Jahrhundert lang in seiner Wohnung aufbewahrt hatte.

Eine Arte-Doku über den seltsamen Herrn Gurlitt, der weit über 1000 Kunstwerken fast ein halbes Jahrhundert lang in seiner Wohnung aufbewahrt hatte.

Rückgabeanspruche? Höchstens bei drei Prozent aus dieser Sammlung: Die Anwälte von Cornelius Gurlitt gehen in die Offensive und verteidigen dessen Haltung.

Gurlitt, zweiter Teil: Der Erbe des Nazi-Kunstsammlers gibt den Besitz weiterer 60 Werke bekannt, darunter Arbeiten von Monet, Renoir oder Picasso. Sie lagerten in seinem Salzburger Haus.

Julius H. Schoeps über den Umgang mit Raubkunst, nötige Gesetzesänderungen, verdächtige Bilder in Ministerien und die Verantwortung der deutschen Museen

Gurlitt war kein Einzelfall: Die Kunstbranche konfrontiert sich in Köln mit ihrer Geschichte und Geschäftspraxis.
Der Fall Gurlitt bekommt eine völlig neue Wendung. Nach Angaben seines Anwalts erwägt der Münchner Kunstsammler Cornelius Gurlitt die Rückgabe von Bildern aus seiner Sammlung.
Der Potsdamer Kunsthistoriker Andreas Hüneke über den Fall Gurlitt und die Forschung zur „Entarteten Kunst“

Wie wird der sensationelle Schwabinger Kunstfund aufgearbeitet? Ingeborg Berggreen-Merkel, Leiterin der Taskforce zur Erforschung der Sammlung Gurlitt, über Verjährung, schlechtes Gewissen – und die vielen Anfragen der Erben.

Der Fund des spektakulären Schwabinger Kunstschatzes von Cornelius Gurlitt hat eine Debatte im bayrischen Landtag ausgelöst. Justizminister Winfried Bausback gestand schwere Versäumnisse ein.
25 Jahre Kulturstiftung der Länder: Ohne sie stünde es schlecht um das nationale Erbe. Auch im Fall Gurlitt kann sie helfen.
Nun, da Cornelius Gurlitt zumindest einen Teil der 2011 konfiszierten Kunstwerke zurückerhalten soll, stellen sich neue Fragen: Neben jener, wie zukünftig deren Sicherheit gewährleistet werden soll, geht es auch darum, überhaupt Kontakt mit dem abgetauchten Kunstsammler aufzunehmen.

Die Taskforce zum Schwabinger Kunstfund sucht den Kontakt zum Kunsthändlersohn Cornelius Gurlitt. „Dies ist ein äußerst komplexer Sachverhalt mit rechtlichen, moralischen, historischen Aspekten“ sagte die Leiterin der Taskforce, Ingeborg Berggreen-Merkel.

Noch liegen alle Bilder aus Gurlitts Wohnung in staatlichen Kammern. Beschlagnahmt wegen Steuerhinterziehung. Aber bis zu 400 unverdächtige Bilder sollen ihm nun möglichst schnell zurückgegeben werden. Zu Recht – denn auch ihm ist Unrecht geschehen.

Das wirft ein schlechtes Licht auf den deutschen Staat: Im Umgang mit NS-Beutekunst handelt er zögerlich und ineffektiv. Sagt Anne Webber von der „Commission for Looted Art“ in London.

Mit einer Reporterin hat Cornelius Gurlitt nun erstmals über seine Beweggründe gesprochen, 1406 zum Teil verschollen geglaubte Kunstwerke über Jahrzehnte in der eigenen Wohnung gelagert zu haben. Dabei offenbart sich einer, der sich ohne jeden Zweifel für den rechtmäßigen Besitzer der Sammlung hält.

Der Besitzer der sichergestellten Gemälde in München will diese nicht freiwillig zurückgeben. Er liebe die Bilder mehr als alles andere, Justiz und Öffentlichkeit stellten "alles falsch dar".
Wer wusste was beim spektakulären Schwabinger Kunstfund? Bayern und der Bund schieben die Verantwortlichkeiten über die dilettantischen Informationspolitik zum Gurlitt-Konvolut hin und her.

Dix, Daumier, Delacroix: 25 Bilder der Gurlitt-Sammlung stehen online. Aber die Qualität der Website lässt zu wünschen übrig. Der Ärger von Nachfahren, die Einsicht gewinnen wollen, dürfte sich so nur steigern.

Der Kunstfund in München befeuert die Fantasie. Doch um die Bilder geht es weniger: Ihr Wert definiert sich durch den Stempel "Drittes Reich". Was sagt das über das tatsächliche Kunstinteresse aus?

Die Behörden beugen sich dem öffentlichen Druck: Eine erste Liste mit Werken aus der spektakulären Sammlung des Münchners Cornelius Gurlitt steht nun im Internet - unter den Zugriffszahlen brach der Server der Seite allerdings zeitweise zusammen.

Nach dem spektakulären Münchner Kunstfund will die Bundesregierung eine Liste der Werke mit unklarer Erwerbsgeschichte veröffentlichen. Der Jüdische Weltkongress kritisiert, dass bereits wertvolle Zeit vergeudet worden sei.

Der 79-jährige Kunstsammler Cornelius Gurlitt hatte in seiner Wohnung über 1400 Gemälde gehortet. Nun wurde er beobachtet, wie er durch ein Schwabinger Einkaufszentrum bummelt.

Die Amerikaner wollen eine schnelle Rückgabe der Meisterwerke an die Eigentümer, Kulturstaatsminister Neumann drängt auf rasche Aufklärung, das bayerische Justizministerium will vermitteln: Der politische Druck im sensationellen Gurlitt-Kunstfund wächst.
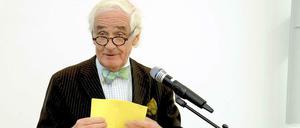
Der Berliner Anwalt und Kunstexperte Peter Raue fordert die Veröffentlichung des Münchner Kunstfundes. Nur so, sagt er, können Eigentumsrechte geltend gemacht werden. Und er regt an, wie der Staat sich mit dem Besitzer der 1400 von den Behörden beschlagnahmten Werke einigen könnte.
Der Druck auf die Behörden nimmt zu, das internationale Echo ist groß. Museen melden Ansprüche an, Experten fordern die Veröffentlichung der Werke aus dem Münchner Kunstfund, auch das Zentralregister für Raub- und Beutekunst in London.