
© dpa/Ralf Hirschberger
Zersplitterung ist nicht nur schlecht: Die Ost-Kommunalwahlen könnten einen Weg aus der Demokratiekrise weisen
Am Sonntag geht es nicht nur um Europa. Die gleichzeitigen Kommunalwahlen, besonders in vier Ostländern, sind mehr als ein Stimmungstest: Sie zeigen die Macht der „Sonstigen“ auf dem Wahlzettel.

Stand:
Alle reden von Europa. Wenn Sonntag zu den Urnen gerufen wird, geht es aber auch um die Zukunft der Demokratie in Deutschland – dort, wo sie ganz direkt zu spüren ist.
In sieben Bundesländern finden mit der Europawahl auch Kommunalwahlen statt. 23,3 Millionen Menschen sind dabei aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt wird in vier der fünf Ostländer. In Brandenburg und Sachsen gilt die Kommunalwahl als Stimmungstest vor den Landtagswahlen im September.
Besonders im Osten bestimmt die Sorge vor einer „blauen Welle“ den politischen Diskurs. Wie stark wird die AfD, die in vielen Dörfern flächendeckend Plakate geklebt hat, in den Gemeindevertretungen und Kreistagen?
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Die Antwort hängt immer weniger am Abschneiden der großen Parteien CDU, SPD oder Grüne. Die entscheidende Rolle spielen vielmehr: Wählervereinigungen, Bürgerbündnisse, Initiativen, gar nicht so selten die Freiwillige Feuerwehr, auch schon mal ein Sportverein.
Sie werden in den Kommunen traditionell gern und häufiger gewählt. Doch aus dem gewöhnlichen Wahlverhalten ist ein Trend geworden, der offenkundig Fahrt aufnimmt. Thüringen zeigt es: Dort haben sich bei der Kommunalwahl Ende Mai mehr Wählerinnen und Wähler als zuvor von den großen Parteien abgewandt.
In den neu bestimmten Gemeinderäten in dem Bundesland machen die Stimmen für die sechs größten Parteien im Thüringischen Landtag – das sind Linke, AfD, CDU, SPD, Grüne, FDP – nur noch eine knappe Mehrheit von 53,9 Prozent der Stimmen aus. Alle anderen Stimmen vergaben die Wählerinnen und Wähler an „Sonstige“.
Ähnliches gilt für die Kreistage in Thüringen, wo der Anteil der „Sonstigen“ ebenfalls wuchs, und die Bürgermeister und Oberbürgermeister. Wenn sie überhaupt noch einer Partei angehören, dann meist keiner großen.
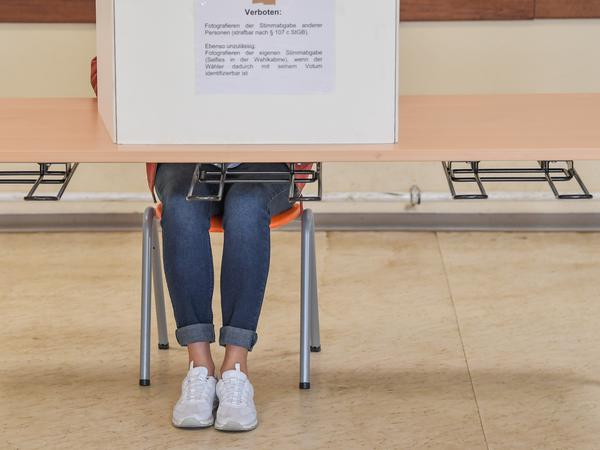
© picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul
Aber warum nimmt das zu? Neben der wachsenden Polarisierung, befeuert von extrem rechten Populisten, ist der große Veränderungsdruck eine Ursache: Die Transformation fordert Entscheidungen, in jeder einzelnen Kommune. Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende, Ernährungswende – überall verändert sich der Lebensalltag konkret.
Das motiviert Wähler zur Vertretung der eigenen Interessen, ohne die Hürden einer Parteilinie, ja, und auch zur Abwehr, etwa von Windparks, nach der Logik: Unser Dorf soll schöner bleiben. Thüringen wird mit den Gewinnen der Nicht-Parteien vor Ort wohl nicht allein bleiben.
Was bedeutet die neue Macht der „Sonstigen“ für die Demokratie? Zunächst manifestiert sich darin die Vertrauenskrise: In zahlreichen Dörfern und Städten werden die großen Parteien mindestens in den nächsten fünf Jahren (noch) weniger Wirkmacht und Präsenz haben. Das schwächt die Verankerung, die im Osten ohnehin gering ist. Schon heute sind vor allem auf dem Land abseits der größeren Städte nicht mehr genügend Menschen zu finden, die für SPD oder CDU als Kandidaten für Gemeindevertretungen antreten. Das dürfte sich verschärfen.
Sensibel außerdem: die Abgrenzung zur AfD. Während alle großen demokratischen Parteien bekennen, dass die Brandmauer auch in der Kommune stehen muss, bleibt diese Frage bei Wählervereinigungen teils unbeantwortet. Ein Teil des Zuspruchs für die „Sonstigen“ könnte sich sogar daran festmachen, dass sie eine „Verteufelung“ der AfD mit Verweis auf Sachpolitik ablehnen.
Vor allem in den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen droht mit dem starken Zuspruch für Wählervereinigungen Fragmentierung: viele kleine Fraktionen statt überschaubar wenige große. Komplizierte Mehrheitsfindung statt berechenbarer Bündnisse.
Schadet diese Zersplitterung? Für die Kommunen scheint die These zumindest nicht belegt. Im Prozess des Aushandelns der besten Lösungen ist sicher noch mehr Geschick der Bürgermeister und Landräte gefragt, damit Entscheidungen auch getroffen werden, keine Blockaden und Stillstand eintreten.
Das ist ein Risiko. Doch in der Stärke der „Sonstigen“ liegt vor allem eine Chance. Die Vielstimmigkeit, die Repräsentanz vieler Interessen in den lokalen Vertretungen kann gerade jetzt dazu beitragen, dass Demokratie gewinnt und zurückgewinnt: Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
- AfD
- Brandenburg
- CDU
- Die Grünen
- Energiewende
- Europawahl
- FDP
- Kommunalwahlen Brandenburg
- Sachsen
- SPD
- Thüringen
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- false