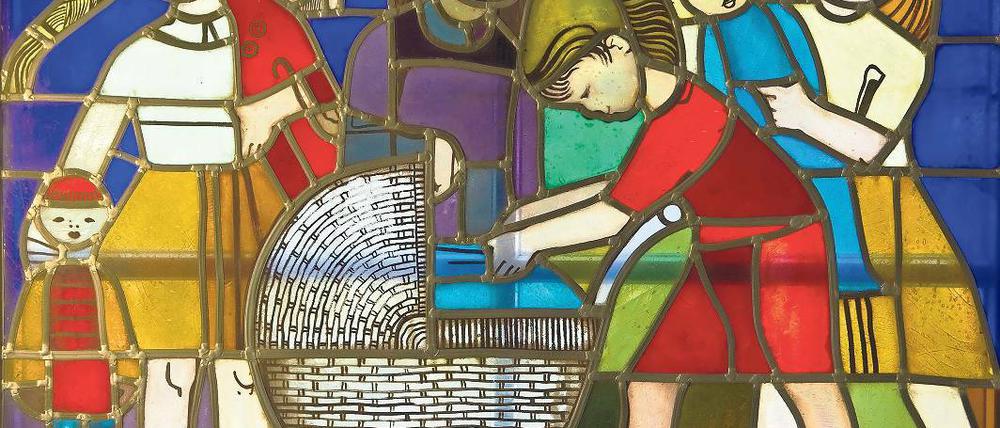
© dpa
Schülerbafög: Auslegungssache
100 Euro Abi-Bafög gibt es nur in Brandenburg. Rot-Rot ist damit rundum zufrieden. Bei einer Untersuchung blieben aber wichtige Fragen offen – sagt der zuständige Forscher.
Stand:
Potsdam - Er ist der Wissenschaftler, der jetzt erstmals untersucht hat, ob das brandenburgische „Schüler-Bafög“ tatsächlich etwas taugt. Der Mann heißt Tilo Wendler, Jahrgang 1972, ist Professor für Quantitative Methoden und Wirtschaftsinformatik, vorher an der Technischen Hochschule in Wildau, seit April 2013 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin (HTW). Er sei parteilos, und habe persönlich keinen Cent für die Expertise bekommen, sagt Wendler.
Es ist nämlich sein Werk, das das brandenburgische Kabinett am Dienstag verabschiedet hat und das Wissenschaftsministerin Sabine Kunst (parteilos) und Bildungsministerin Martina Münch (SPD) danach vor Journalisten vorstellten. Es ist der Abschlussbericht zur „Umsetzung und Wirkung“ des Schülerbafögs, eine wissenschaftliche Untersuchung der TFH Wildau im Auftrag des Wissenschaftsministeriums, 120 Seiten dick, und ein Politikum. Das war vorher klar.
Wendler, dafür ist er Spezialist, hat dafür eine Befragung durchgeführt unter denen, die das monatliche 100-Euro-Stipendium aus der Landeskasse erhalten. Das gibt es nur hierzulande, nirgendwo sonst in Deutschland. Empfänger sind rund 2300 Abiturienten an Gymnasien, Oberstufenzentren und Gesamtschulen aus sozial schwächeren Familien, deren Eltern monatlich weniger als 2000 Euro Netto verdienen, so die Faustregel. Das Schüler-Bafög ist das bildungspolitische Symbolprojekt der rot-roten Landesregierung, von einer breiten Allianz aus CDU, Grünen, FDP, aber auch der Bildungsgewerkschaft (GEW) schon bei der Einführung im Jahr 2010 als Etikettenschwindel und als Placebo kritisiert. Deshalb war nun die erste Evaluation mit besonderer Spannung erwartet worden.
Für die Umfrage wurden 2100 Geförderte angeschrieben, anonym, 852 haben geantwortet – rund 41 Prozent, was einer aussagekräftigen Rücklaufquote entspricht. Und auf die eine Kernfrage, ob das Schüler-Bafög und die damit absolvierte Ausbildung das Interesse an einer weiteren Ausbildung, wie zum Beispiel an einem Studium, geweckt habe, antworteten tatsächlich 74,6 Prozent mit Ja. Die zweite Kernfrage lautete, ob das Schülerbafög „eine schulische Ausbildung (Fachhochschulreife oder Abitur) ermöglicht hat, die Sie ohne die Unterstützung nicht hätten absolvieren können“. Hier antworteten 50,6 Prozent mit Ja, 49,4 Prozent mit Nein. Auf genau diese beiden Zahlen beriefen sich Münch und Kunst, als sie betonten, dass sich das Schüler-Bafög bewährt habe. „Es hat sich zu einem einmaligen Erfolgsmodell entwickelt“, sagte Münch.
Allerdings gibt es schon Differenzen bei der Frage, wer denn befragt wurde: Die Schüler selbst, so die Antworten von Kunst und Münch. Wendler, der auf der Pressekonferenz in Potsdam nicht dabei war, sagt dagegen: Er gehe davon aus, dass es in der Regel die Eltern waren, denen das Geld ja auch überwiesen werde, die befragt worden sind.
Und auch bei der Bewertung ist er zurückhaltend. Das Schüler-Bafög war ausdrücklich mit dem Ziel eingeführt worden, Anreiz zu sein, damit Zehntklässler aus sozial schwächeren Familien nicht für eine Lehre die Schule verlassen, sondern das Abitur machen. Ob dies geschieht, darauf lasse seine Untersuchung keine Rückschlüsse zu, bestätigt Wendler. Dafür hätte man Abbrecher befragen müssen, was aus Datenschutzgründen aber nicht möglich gewesen sei. So kommt sein Abschlussbericht zu einem Befund, den Münch und Kunst nicht vortrugen, Zitat: „Eindeutiger Zusammenhang zwischen Förderung und Wahl des Bildungsweges aufgrund der Höhe der Förderung nicht feststellbar.“ Es werde aber „eine subjektiv positive Wirkung bei den Geförderten“ erzielt. Die freuen sich über die zumeist 100 Euro im Monat. Die sollen, so das Gesetz, für die „Deckung bildungsspezifischer Bedarfe“ dienen, also für Laptops, Bücher. Kontrolliert wird das nicht. Umso spannender wäre, wie die Antworten in einer anonymen Umfrage ausgefallen wären, ob das Geld dafür verwendet wird. Die Frage wurde nicht gestellt. „Das hätte man machen können. Punkt“, räumt Wendler ein. Die Methodik habe allein bei ihm gelegen. „Eine inhaltliche Einflussnahme des Wissenschaftsministeriums hat es nicht gegeben.“ Er kennt die Grenzen seiner Untersuchung. „Es ist eine Befragung, kein Freibrief.“ Auf die Frage, ob Brandenburgs Schüler-Bafög nun etwas taugt, antwortet er dann doch so: „Ja, weil die betreffenden Schüler tendenziell beeinflusst werden, weitergehende Perspektiven zu suchen.“ Bestätigt sieht sich der Wissenschaftler in einer Sozial-Karte, nach der in der Prignitz 40 Prozent der Elft-, Zwölft- und Dreizehntklässler das Schüler-Bafög erhalten, in Oberspreewald-Lausitz 28,3 Prozent, in Spree-Neiße 27,4 Prozent, in Potsdam dagegen nur 9,3 Prozent, in Potsdam-Mittelmark 9,1 Prozent und im Havelland 11,4 Prozent: Brandenburgs Armutsgefälle.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: