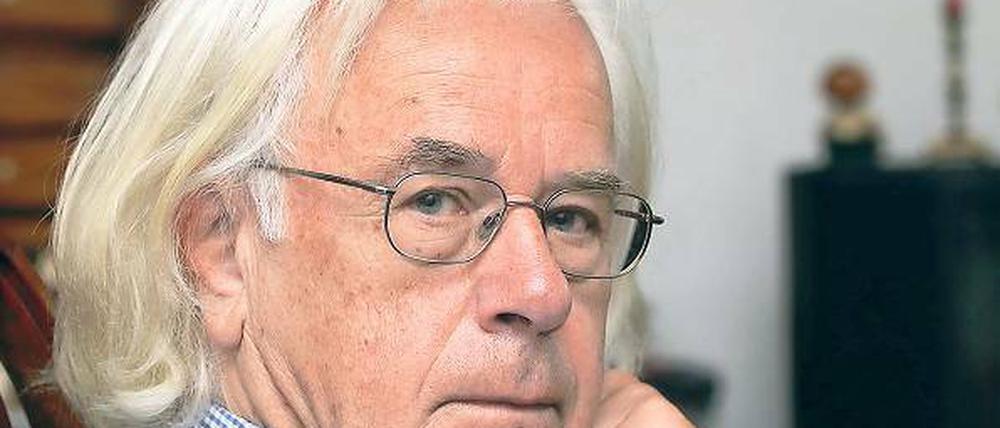
© Manfred Thomas
Von Heidi Jäger: Zwischen Defa und Schamanen
Rainer Simon wird 70 / Das Filmmuseum ehrt ihn mit einem Filmnachmittag und einer Ausstellung
Stand:
Die Literatur ist sein neuer Verbündeter und sein Zuhause zwischen den Welten. Gerade hat der Regisseur ein Kinderbuch fertiggestellt. Ein Roman ist in Arbeit. Dass Rainer Simon noch immer in Potsdam wohnt und nicht in Südamerika, liegt allein an der deutschen Sprache. Denn er weiß, dass es oft auf Nuancen ankommt, will man andere verstehen und selbst verstanden werden. Und dem Filmemacher, Autor und Fotograf geht es um Verständnis, um ein sich Zuwenden über Kontinente hinweg. Ein Anliegen, das er seit der Wende als feinsinniger und beherzter Weltenbummler mit Kunst und menschlichem Zutun zu leben versteht.
Einen Tag nach seinem Geburtstag ehrt am kommenden Mittwoch das Filmmuseum Rainer Simon zu seinem 70. Geburtstag und zeigt den unvergessenen Film „Wie heiratet man einen König“, den er 1968 bei der Defa drehte. Der Regisseur wird nicht dabei sein, wie er kurz vor seinem Abflug nach Ägypten am Telefon sagte. In dem Kinderfilm ging es ihm wie auch in späteren Arbeiten um Gerechtigkeit, um das Einstehen für andere. Die Aufführung dieses modernen Märchens mit der schönen Holländerin Cox Habemma als kluge Bauerntochter rollt schon mal den Teppich aus für eine größere Ehrung, die dem Jubilar ab Juni zuteil wird. Dann kann er im Filmmuseum seine Foyerausstellung „In den Spiegel der Seele schauen – Fotos aus Amerika“ zeigen, die auch zurückführt zu seiner biografie-prägenden „Besteigung des Chimborazo“, zu seiner Lebenswende.
Als sich der Regisseur 1988 für ein Filmprojekt auf die Spuren von Alexander von Humboldt begab, fand er auch eine eigene neue Lebensspur. Sie führt ihn seitdem fast jedes Jahr nach Ecuador, zu seinen neuen indigenen Freunden im Hochland der Anden, deren Wellblechhütte mit Hühnern und Schweinen davor sein zweites Zuhause geworden ist. „Das Nahe im Fremden sehen. Das Fremde in die Nähe holen“, heißt eine Maxime Rainer Simons, und damit schließt er auch ganz praktische Hilfe ein, wenn er zum Beispiel die Begabungen seiner acht Patenkinder mit Enthusiasmus fördert und in Ausstellungen in Potsdam zur Schau stellte. Als sein bester Freund, der Maler Ricardo, an einem Tumor erkrankte, sammelte er das Geld für eine Operation.
Rainer Simon sieht sich selbst als ein Schüler, wenn er in das Reich der spirituelle Kultur der Schamanen eintaucht, das ihm neue geistige Welten offenbart. In seinem Film „Der Ruf der Fayu Ujmu“ ließ er die Kraft der Urwald-Geister bildkräftig auferstehen. Auch in seinem autobiografischen Buch „Fernes Land“ stellte er die Legenden der Zapara-Indianer Ecuadors seinem Lebensrückblick auf die DDR voran. Doch Rainer Simon hat sein erstes Leben nicht gänzlich abgeschüttelt.
Das verbrachte der gebürtige Sachse aus Hainichen, der bei seiner geschiedenen Mutter, einer Sekretärin, aufwuchs, und an der Filmhochschule Babelsberg studierte, vor allem bei der Defa. Eine Familie ist sie für ihn nicht gewesen, wie viele einstige Mitarbeiter heute von dem Studio sagen. „Aber sie war ein Ort, an dem meine wichtigsten Filme entstanden sind. Ich frage mich heute schon, ob ich woanders solche Filme hätte drehen können.“ Doch Rainer Simon erinnert sich auch an die Konflikte zwischen den Machern und Leitern und unterhalb der Macher. „Jeder hat sich auf seine Weise durchgeschlagen. Ich bin über mein Ergebnis ganz froh. Mir ist es gelungen, nichts tun zu müssen, sowohl in der alten als auch in der neuen Welt, das gegen mein Gewissen geht.“ Rainer Simon galt in der DDR als unsicherer Geist, der seine Meinung offen sagte und auch ins Visier der Staatssicherheit geriet. Themen wie Opportunismus und Widerstand bearbeitete er ebenso wie Schein und Realität. Der Frust auf die Defa, wie nach dem Verbot des Films „Jadup und Boel“, in dem er Nachkriegsträume mit dem Real-Sozialismus konfrontierte, hat sich mit Sicht auf die jetzige Filmpolitik relativiert. „Ich glaube, dass die Zensur des Geldes genauso schlimm ist wie die Zensur der Ideologie.“
Mit seinen Defa-Arbeiten, oft ungewöhnliche Zugriffe auf Literaturvorlagen mit dichten, aufwühlenden Bildern, reist er noch heute durch die Welt. Wie mit „Die Frau und der Fremde“, dem einzigen Defa-Film, der je mit einem „Goldenen Bär“ der Berlinale im damaligen Westberlin ausgezeichnet wurde und nach einer Novelle von Leonhard Frank über die seelischen Folgen des Ersten Weltkriegs reflektiert. Zehn Wochen war Rainer Simon 2008 in den USA und Kanada unterwegs, eingeladen von der Defa Film Library in Amherst/Massachusetts, die mit etwa 400 Filmen die größte Sammlung von DEFA-Filmen außerhalb Deutschlands besitzt. Schnell merkte er bei seinen Filmgesprächen, dass die Studenten so gut wie nichts über die DDR wissen. Namen wie Bertolt Brecht waren ihnen genauso fremd wie der Begriff Prager Frühling. Geradezu schockiert zeigte sich der Filmemacher über die jungen Leute in den USA, die immer nur lächeln und keinerlei Widerspruchsgeist aufweisen. „Die perfekte Anpassung am Leistungssystem. Kritische Meinungen gibt es dort nur privat.“ Und Rainer Simon provozierte durchaus, als er die Berliner Mauer als Symbol der Unmenschlichkeit mit der zwischen Mexiko und den USA verglich, „an der noch viel mehr Menschen starben und noch immer sterben. Die Studenten nahmen auch das brav zur Kenntnis.“
2010 war er dann mit einem Koffer voll DEFA-Filmen in Mexiko und in Bolivien auf Tour. Und wieder machte er aus seiner politischen Haltung kein Hehl. „In Bolivien, wo gerade ein Gesetz gegen Rassismus und Diskriminierung erlassen wurde, beschimpfte man den Präsidenten, dass das ein Angriff auf die Pressefreiheit sei. Ich bekannte durchaus meine Sympathien für Evo Morales, der nur deswegen kritisiert wird, weil es für viele Weiße ein Skandal ist, dass sie von einem Indigo regiert werden,“ betont Rainer Simon, der aber auch überrascht war über das Bild der Lateinamerikaner über die einstige DDR. „Sie glaubten, dass wir eingemauert und in Lagern lebten.“
Wenn der 70-Jährige heute von seinen Reisen aus Lateinamerika in die deutsche Heimat zurückkehrt, findet er manche Diskussionen, wie über Hartz IV-Empfänger, geradezu absurd. „Wenn die Situation so dramatisch ist, sollen die Leute auf die Straße gehen. In anderen Teilen der Welt gibt es wirkliche existentielle Probleme.“ Ihm geht es um fundamentale Ungerechtigkeiten und gegen die zieht er weiter zu Felde, wie in seinem Kinderbuch „Die wunderbaren Abenteuer des Emanuel“, einer fantastischen Geschichte über einen kleinen Jungen in Südamerika, der allein zurecht kommen muss. Und sicher auch in seinem neuen Roman. Ob er einen Verlag dafür findet, weiß er nicht, „aber im Alter macht man Sachen, die einen selber ein Stück weiter bringen.“ Auszüge daraus verschickt Rainer Simon gerade an interessierte Leser, die ihm vielleicht im Geiste nahe stehen.
Gern würde er auch wieder Filme drehen, aber nur wenn jemand sagen würde: „Hier hast du das Geld“. Demütigungen von Filmproduzenten, wie er sie nach der Wende auch in den Babelsberger Filmstudios erlebte, erspart er sich. Dann schreibt er lieber weiter Bücher und schaut mit seinem Fotoapparat „hinter die Bilder“, in die Seelen hinein.
„Wie heiratet man einen König“: zu sehen am 12. Januar, 16 Uhr, Filmmuseum
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: