Berliner Künstlerprogramm des DAAD: Wer teilnimmt, hat wirklich etwas zu sagen
Seit 1963 vergibt der DAAD einjährige Stipendien für internationale Kulturschaffende. Ausstellen können sie in einer Galerie in Kreuzberg. Ein Besuch vor Ort.
Stand:
Riesige Bojen liegen wie gestrandete Wale im Raum. Sie sind verkrustet, überzogen von Kalk und Muscheln. Dem Meer entzogen und ihres ursprünglichen Kontextes als Grenzmarkierungen beraubt, bekommen sie etwas Dystopisches, gebrochen Monumentales, als handele es sich um Denkmäler, die während einer Revolution gestürzt wurden. Sie erzählen plötzlich eine andere Geschichte als die, für die sie gebaut wurden.
„Here on the Edge of the Sea we sit” ist eine Ausstellung von Ting-Jung Chen, die im März in der DAAD-Galerie in der Oranienstraße zu sehen war. Die taiwanesische Künstlerin erforscht mit ihren Arbeiten, wie Identitäten und Machtstrukturen etabliert werden.
Und will damit zugleich deren Gemachtheit, ihre Konstruktion offenlegen, sodass im Prozess der Betrachtung alternative Denkweisen möglich werden. Beim näheren Hinsehen zeigt sich, dass die Bojen, die so massiv wirken, nur aus Pappmaché und Farbe bestehen und eigentlich sehr fragil sind.

© Diana Pfammatter
Dazu erklingen über Kopfhörer Geräusche, Schnipsel von Musik, Sprachfetzen. Sie sind den Reden diverser Politiker entnommen, aus afrikanischen Ländern, auch ein amerikanischer Präsident ist zu hören, allerdings nicht der aktuelle. Ting-Jung Chen ist vor allem Klangkünstlerin, und so verschwimmen in dieser Ausstellung die Sinneseindrücke von Hören, Sehen, Fühlen, man verliert den Boden unter den Füßen, Vergangenheit und Gegenwart fließen ineinander.
Ein Jahr lang, von März 2024 bis März 2025, war Chen als Fellow des Berliner Künstlerprogramms des DAAD zu Gast in Berlin und hat während dieser Zeit die Exponate für diese, von Sebastian Dürer und Natalie Keppler kuratierte Ausstellung hergestellt. Sie ist eine von 20 internationale Künstlerinnen und Künstlern, die im Rahmen des Programms jedes Jahr nach Berlin kommen, hier leben und arbeiten.
Das Programm ist in vier Sparten strukturiert: Literatur, Musik, Bildende Künste und Film. „Film kam 1978 als Letztes hinzu, auf Initiative von Ulrich Gregor, der die Forums-Sektion der Berlinale gegründet hat“, erzählt Silvia Fehrmann.

© Andreas Labes
Sie leitet das Künstlerprogramm und damit auch die DAAD-Galerie in der Oranienstraße. Hier können die Fellows das, was sie während ihres Aufenthaltes erarbeitet haben, präsentieren – wobei keine Verpflichtung dazu besteht, während des Aufenthalts etwas zu produzieren.
Man kann die Zeit auch ganz anders nutzen: „Für viele war der Aufenthalt ein biografischer und künstlerischer Wendepunkt und der Beginn einer tiefen Verbindung zu Berlin und der Bundesrepublik Deutschland“, erklärt Fehrmann. Entschleunigung, Konzentration, die Möglichkeit, sich einem Thema mit mehr Tiefe widmen zu können: Auch darum geht es auch bei diesem Stipendium.
Der Name „Berliner Künstlerprogramm des DAAD“ ist dabei ein wenig irreführend, denn tatsächlich ist es das einzige seiner Art, das der DAAD in Deutschland anbietet. Es gibt also zum Beispiel kein „Kölner Künstlerprogramm des DAAD“.
Die Idee, für einen bestimmten Zeitraum Kunstschaffende einzuladen, entstand überall in Europa nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs, traditionellerweise sind die Kommunen Träger dieses Gedankens. Kleinere Städte schreiben zum Beispiel jährlich den Posten des Stadtschreibers aus.
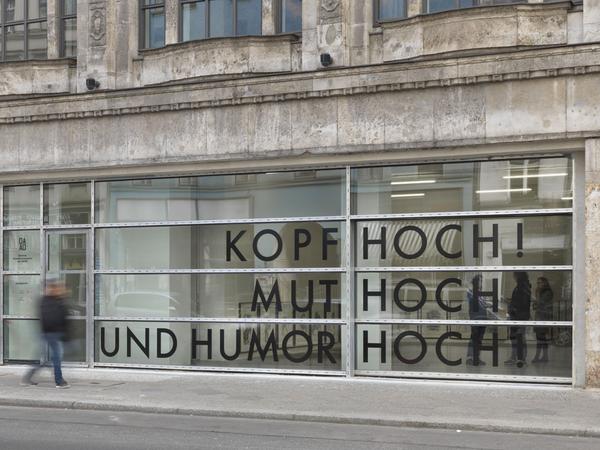
© Jens ziehe
In Berlin ist natürlich alles eine Nummer größer, rund 1200 Fellows waren hier zu Gast, seit das Programm 1963 im ummauerten West-Berlin gegründet wurde. Die Mittel kommen vom Auswärtigen Amt und dem Land Berlin, mit einem Aufenthalt wird international für Deutschland geworben.
Manche der Stipendiaten werden später richtig prominent, im Laufe der Jahrzehnte sind sechs Literaturnobelpreisträger (Swetlana Alexijewitsch, Mario Vargas Llosa, Imre Kertész, Gao Xingjian, Olga Tokarczuk, Peter Handke) und drei Oscar-Preisträger (István Szabó, Asghar Farhadi, Sebastián Lelio) zusammengekommen.
Es ist bereits der dritte Standort
Silva Fehrmann führt durch die Räume, in denen sich die bereits dritte DAAD-Galerie befindet. Die erste war über dem (leider schon seit Längerem geschlossenen) Café Einstein in der Kurfürstenstraße eingerichtet, die zweite in der Zimmerstraße. Die Oranienstraße 161 ist seit 2017 der Standort der Galerie.
Das Haus hat eine interessante Geschichte. Erbaut wurde es 1910 nach Plänen des ungarisch-jüdischen Architekten Oskar Kaufmann, der auch die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz entworfen hat. Kaufmann war spezialisiert auf Theaterbauten, und auch in der Oranienstraße etablierte sich, nachdem sich hier zunächst ein Schuhgeschäft befunden hat, bald ein Theater oder genauer: ein Filmtheater: das Kino „Oranien-Theater“. Es bestand bis 1966.

© Moritz Geßner, arts/beats
Danach hatte das Haus verschiedenen Nutzer. Den Umbau zur DAAD-Galerie plante das Architekturbüro Kühn-Malvezzi. Noch heute sind die Spuren der Geschichte lesbar, im Stuck, der Maserung der Türen oder im herrlichen Jugendstil-Treppenhaus, das sich völlig unerwartet hinter einer Tür öffnet und das Besucher unbedingt besichtigen sollten.
María Negroni kommt herein und sagt kurz Hallo. Die argentinische Dichterin gehört zu den aktuellen Stipendiaten, gerade hatte sie noch oben im ersten Stock der Galerie auf einer Couch gesessen und ein Interview für einen Porträtfilm gegeben. Lyrische Musikalität, radikales Experiment und Metaphernreichtum sind die Kennzeichen ihrer Romane.
Der Andrang ist groß
„Künstlerinnen und Künstler bewerben sich um einen Stipendiumsplatz, eine Jury trifft dann die Entscheidung“, erklärt Silvie Fehrmann. Der Andrang sei groß, in der Sparte Musik kamen zuletzt 500 Bewerber auf vier Plätze.
Am 15. Mai eröffnet die nächste Ausstellung in der DAAD-Galerie, gestaltet von der amerikanischen Lyrikerin Claudia Rankine aus New York. „For Real For Real“ heißt die Schau. Dieser doppeldeutige Titel kann im Deutschen so viel wie „Echt jetzt?“ bedeuten, aber auch „Wirklich wahr!“. Er drückt also Zweifel genauso aus wie das Gegenteil, die Affirmation, und vereint beides in derselben Phrase.

© Diana Pfammatter
Rankine hat das „Racial Imaginary Institute“ gegründet, ein Künstlerkollektiv, das sich als Labor versteht. Es will das, was die Gesellschaft als Kollektiv beim Thema Rasse und Rassismus „imaginiert“, untersuchen und entmystifizieren – ein immer wieder und auch gerade jetzt hochaktuelles Thema.
Im Gegensatz zu den Haudrauf-Methoden, die aus dem Weißen Haus kommen, will Claudia Rankine positive Gegenbilder stärken und die „Poetry of Being“, die Poesie des Daseins, feiern. Videos und Objekte sollen in der Ausstellung zu sehen sein, am 3. Juni hält Rankine auch die Eröffnungsrede des Berliner Poesiefestivals. Man darf darauf gespannt sein, denn so viel sollte klar geworden sein: Wer am Berliner Künstlerprogramm des DAAD teilnimmt, der hat wirklich etwas zu sagen.
- Berlinale
- Berliner Volksbühne
- Friedrichshain-Kreuzberg
- Kino
- Kunst in Berlin
- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: