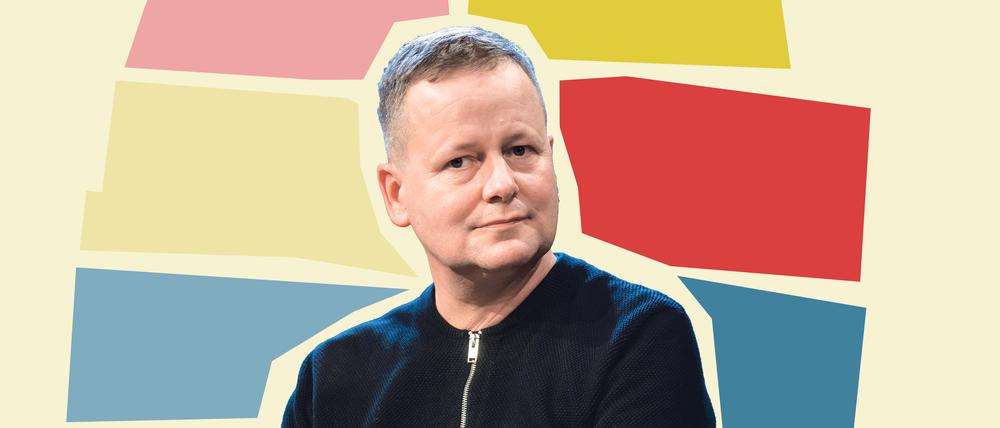
© Gestaltung: Tagesspiegel/IMAGO/Emmanuele Contini
Klaus Lederers Vision für 2030: „Berlin braucht öffentliche Räte für die großen Zukunftsfragen“
Die Berliner Koalition macht Politik für Privilegierte: Zaun um den Görli, mehr Polizeiwachen, NFL-Spiele. Stattdessen bräuchte es soziale Teilhabe und öffentliche Räte, meint Ex-Kultursenator Lederer.
Berlin eilt mancher Ruf voraus. Nicht jeder ist schmeichelhaft. Einer war aber immer ein echtes Pfund und schwer zu bestreiten: Berlin ist Sehnsuchts- und Zufluchtsort, Berliner Luft atmet Freiheit, hier gibt’s Offenheit und Raum, gemeinsam ganz verschieden sein zu können.
Das ist zwar (vor allem im Vergleich mit anderen Gegenden) noch immer so. Aber dieses Berlin steht massiv unter Druck und Stress. Eine Stadtpolitik, die das nicht sieht, riskiert, alles zu verspielen, was Berlin so besonders und lebenswert macht. In meiner Vision für Berlin im Jahr 2030 hat sich das geändert. Berlin diskutiert in einer breiten Debatte: Welche Stadt und wessen Stadt wollen wir sein? Wie soll ein Berlin 2050 aussehen, in dem wir gern leben wollen? Wie kommen wir dort hin und was brauchen wir dafür? Damit hat Berlin im Jahr 2030 wieder begonnen, seine Zukunft bewusst zu gestalten.
Soziale, politische und kulturelle Teilhabe bedeutet Freiheit
In den politischen Sonn- und Feiertagsreden der Berliner Politik klingt es oft so, als seien „Freiheit“ und „Berlin“ voraussetzungslos synonym. Das darin zum Ausdruck kommende Freiheitsverständnis ruft pathetisch Luftbrücke, Volksaufstand 1953 und Mauerfall auf, als erklärte das bereits alles. Aber Berlin als „Stadt der Freiheit“ – das hatte nie nur mit einem durch kollektive Erinnerung geprägten Mindset von „Toleranz und Offenheit des Geistes“ zu tun. (Ohnehin bereinigt eine solche Sicht die wechselvolle Geschichte der Stadt um viele Widersprüche.)
Freiheit in Berlin – das war und ist zuallererst eine Frage der sozialen, politischen und kulturellen Teilhabe möglichst vieler Menschen, auch eine Frage von relativer ökonomischer Gleichheit. Denn es geht ja nicht nur um die Freiheit „vom Staat“ all derjenigen, die sich Berlin „leisten können“. Es geht um die Freiheit aller in Berlin lebenden Menschen, ihre urbanen Lebensbedingungen gemeinsam zu gestalten.
Günstige historische Bedingungen
Nach der Vereinigung und dem Ende der beiden hoch subventionierten „Sonderwirtschaftszonen“ Ost-Berlin und West-Berlin hat die rasante Deindustrialisierung Berlin hart getroffen. Dennoch: Die Lebenshaltungskosten waren in den 1990ern für die weitaus meisten Menschen erschwinglich. Prekäre Lebensphasen bedrohten – noch vor Hartz IV – nicht sofort die Existenz. Es herrschte ein vergleichsweise offenes gesellschaftliches Klima, wenn auch nicht unbedingt in der Stadtpolitik. Schon vor 1989 versprachen beide Stadthälften ein Entrinnen aus der Enge der Provinz.
Was den nach wie vor lebendigen Mythos Berlins als besondere und freie Metropole und als Kulturstadt ausmacht, konnte entstehen, weil der ökonomische Verwertungsdruck gering war und weil soziale Perspektiven und Lebensrisiken für sehr viel mehr Menschen kalkulierbar waren als heute. Und es gab – bedingt durch den wirtschaftlichen Umbruch – Raum und Orte für kreative Nischen, für die Entwicklung von Subkulturen, alternative Lebensentwürfe und künstlerische Avantgarde, auch für Internationalität. Berlin als Stadt der Freiheit ist zuerst ein Resultat günstiger historischer Gelingensbedingungen.
Soziale Spaltung, Verdrängung, verpasste Investitionen
Heute sind die Verhältnisse andere. In Berlin bist du jetzt weniger das, was du bist, als das, was du hast. Besonders seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 flossen Finanzströme ins „Betongold“ der Metropolen. Berlin traf das aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus für Investitionen besonders heftig, soziale Spaltung und Verdrängung exponenzierten sich. Lange wurde das nicht als Problem erkannt, sondern von der Stadtpolitik als „wirtschaftlicher Impuls“ sogar begrüßt und gefördert. So ist es eigentlich gerade wieder.
Alle Videos aus der Serie „Berlin 2030“
Lange unterlassene Investitionen strapazieren Berlins Infrastruktur inzwischen massiv. Das rächt sich. ÖPNV, Bildung und Wissenschaft, Gesundheitswesen und Kultur, aber auch der Zustand des öffentlichen Raums halten nicht mehr mit der nach wie vor wachsenden Stadt mit. Und während früher die mobilen Kreativen den internationalen Charakter Berlins prägten, wird die Stadt heute durch Flucht und erzwungene Migration wieder daran erinnert, dass sie keine Insel der Seligen ist, der die Probleme sonst wo auf unserem Planeten herzlich egal sein können.
Im Umgang mit diesen Herausforderungen wird sich herausschälen, ob Berlin zukünftig eine Stadt der Freiheit bleibt. Eine Stadt für Alle, in der die Gesundheit älterer Menschen in überhitzten Sommermonaten genauso Platz hat wie das Bedürfnis, auch als prekär lebender Mensch die Chance auf leistbaren Wohnraum oder als geflüchteter Mensch eine gute Bildung zu erhalten – oder auch ohne viel Moos in durchtanzten Clubnächten unterschiedlichsten Menschen zu begegnen.
Berlin sollte sich nicht an nostalgisch gefärbten Ideen von gestern orientieren, deren Voraussetzungen gerade vor unser aller Augen erodieren. Wir sollten als Civitas – im transparenten und kontroversen Diskurs – eine Idee von gestaltbarer Zukunft entwickeln und danach fragen, welche Bedingungen die Leute brauchen, um daran mitzutun. Berlin ist immer gut damit gefahren, sich auf die der Stadt selbst innewohnenden Potenziale und Möglichkeiten zu besinnen.
Öffentliche Räte statt leerer Phrasen
Da ist misslich, dass sich die derzeit Berlin regierende Koalition – ihr business as usual, oft erregt und gereizt, nur sehr schlecht kaschierend – entlang ihrer machtpolitischen Binnenlogik irgendwie durchwurstelt. Damit wird sich der Problemstau allerdings eher verschärfen. Nein, eine Zukunftsidee haben die nicht.
„In Berlin müssen die Basics funktionieren“ oder „Machen ist wie wollen, nur krasser“ sind die Poesiealbum-Sätze einer politischen Klasse, die vor allem mit sich im Selbstgespräch verharrt und sich dabei der Illusion hingibt, die massiven Zukunftsherausforderungen Berlins ließen sich über die Köpfe der Leute hinweg mit Motivationscoach-Sprüchen bewältigen.
Man baut einen Zaun um den Görli, organisiert NFL-Spiele und Olympia 2036, Autobahn-Bau und mehr Polizeiwachen, sieht keine Krise bei der BVG – und pflegt so vor allem die Wünsche eines privilegierten Teils von Berlin. Der muss sich nicht mit Rassismus, sozialer Ausgrenzung in Bildung und Kultur, Mobilität ohne Auto, Wohnungssuche im unteren Preissegment, mit Facharztterminen als gesetzlich Versicherte, prekärer Arbeit, schlechter Ausbildung oder mit den in dicht bebauten Quartieren schwerer auszuhaltenden Folgen des Klimawandels herumschlagen. Das zeigt auch, welche Interessen und Ansprüche diese Koalition für legitim oder relevant hält – und welche nicht.
Weil das Problemlösungsvertrauen in die demokratischen Institutionen real abnimmt, könnten wir uns auch auf eine Berliner Tradition aus der friedlichen Revolution 1989/90 besinnen – die „Runden Tische“. Statt Zukunft top-down „zu servieren“: Wie wäre es mit erweiterten demokratischen Formen, in denen es umgekehrt läuft, etwa öffentlichen Räten zu den Zukunftsfragen? Mit Selbstbindung der Politik, deren Ergebnisse ernst zu nehmen? Die Erfahrung politischer Selbstwirksamkeit ist schließlich das beste Mittel gegen autoritären Populismus und kulturkämpferische Ersatzhandlungen. Berlin, die Stadt der Freiheit, als Demokratielabor – das wär’s.
- BERLIN 2030
- BVG
- Friedrichshain-Kreuzberg
- Hartz IV
- Klaus Lederer
- Migration
- Olympische Spiele
- Sozialpolitik
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
