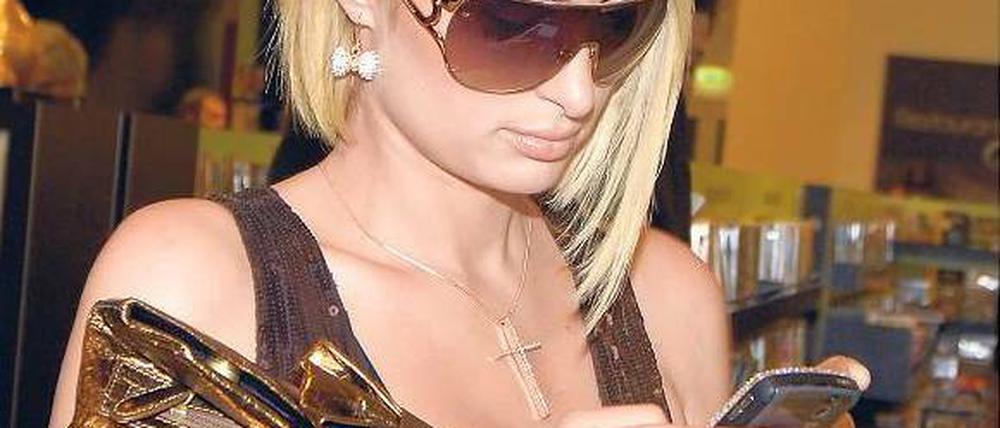
© adolph press/MONET
Internet: Der Konsument genießt und schweigt
Dass im Internet alle mitmachen können, gilt als kulturelle Errungenschaft. Dabei will ein Großteil der Nutzer gar nicht aktiv an der digitalen Weltgemeinschaft teilhaben.
Stand:
Ich möchte lieber nicht – „I would prefer not to.“: Mit diesem Satz ist Bartleby, der rätselhafteste Verweigerer der Literaturgeschichte, bekannt geworden. Der zurückhaltende Büroangestellte aus Herman Melvilles Erzählung will seine Korrekturarbeiten nicht erledigen, er will auch nicht mit dem Chef sprechen. Am Ende will er weder essen noch das Büro verlassen. Er will einfach überhaupt nicht mehr mitmachen.
Auf eine Menge solcher Bartlebys stießen auch die Autoren der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie. Einmal im Jahr wird das Netznutzungsverhalten der Deutschen untersucht, werden Surfgewohnheiten und Interaktionsvorlieben ausgelotet. Die Überraschung 2010: 59 Prozent aller deutschen Netznutzer sind „explizit desinteressiert“ an aktiver Partizipation, „sehr interessiert“ sind dagegen nur noch sieben Prozent. Nicht nur die Nutzerzahlen der deutschen Blogs dümpeln im unteren einstelligen Bereich. Auch zum Twittern fühlt sich nur eine sehr überschaubare Minderheit berufen. An der Ignoranz der bösen alten Massenmedien kann das nicht liegen. Im Gegenteil, Blogger sind Dauergäste in Deutschlands Talkshows, und nirgendwo lieber als bei Twitter schauen Claus Kleber und seine Kollegen dem Volk aufs Maul. Schließlich spricht hier doch die Masse, oder?
Eher nicht, meinen die Autoren der Studie. Im vermeintlichen Mitmachweb herrsche, die Auftraggeber wird das vermutlich freuen, generationsübergreifend vor allem eins: Fernsehzuschauermentalität. Die meisten kommen gucken, bleiben aber unbeteiligt.
Diese Erkenntnis kratzt am fundamentalen Mythos des Mediums. Denn mit dem Web 2.0 schien die mächtige Berieselungsmaschinerie endlich kurz vor der Überwindung. Ade Radio, Zeitung, Glotze, ade einseitige Deutungshoheit, jetzt erheben mal die Zwangsverstummten das Wort. Jeder sein eigener Autor, Kulturproduzent, Bürgerjournalist!
Der Traum ist nicht neu. Schon lange gilt die Möglichkeit der kulturellen und politischen Partizipation als das goldene Kalb der kritisch-linken Medientheorie. „Der Rundfunk muss den Austausch ermöglichen“, forderte Bertolt Brecht schon 1932, er soll „den Hörer als Lieferanten organisieren“. Wenig später beklagte Adorno die verpasste Chance: „Keine Apparatur der Replik hat sich entfaltet.“ Nach einem halben Jahrhundert war das Feindbild dann komplett; der Fernseher drohe „ein Mittel zur symbolischen Unterdrückung“ zu werden, unkte nicht nur Pierre Bourdieu. Der Fernseher, ein flimmerndes Lagerfeuer, in das wortlose Familien zu starren verurteilt sind.
Und heute? Sitzen die Ex-Fernsehzuschauer am liebsten vor Youtube. Das Videoportal belegt einen vorderen Rang bei den deutschen Lieblingswebsites. Womit hier Zeit verbracht wird, erklärte Youtube-Chef Chad Hurley kürzlich so: „Die meisten konsumieren hauptsächlich, ich auch.“ Nur „einige Prozent“ der Nutzer würden selbst Videos hochladen.
Das mag daran liegen, dass das Netz gefühlt voll ist. Die Pionierarbeit – nicht nur bei den Enzyklopädien und Videoportalen – ist getan. Die Zeiten, in denen man noch Nischen besetzen konnte, sind vorbei. Angebote aller Art gibt es reichlich, Antworten auf Fragen, die man gerade erst stellen wollte, meistens auch. Hinzu kommen unzählige Pop-up-Umfragen, Gefällt-mir-Daumen und Kommentarfelder, zwischen denen der Nutzer bei seiner täglichen Navigation hin und hertaumelt. Sie zerren an der Aufmerksamkeit – und kannibalisieren sich dabei selbst.
Andererseits, und das widerspricht der schlichten Ich-Ermüdungs- oder Zeitbudget-These, ist die Lust an Facebook und anderen sozialen Netzwerken ungebrochen. Nielsen verzeichnet hier immer noch beachtliche Zuwächse. 12 Millionen Deutsche schauten im März 2010 mindestens einmal bei Facebook vorbei, im Schnitt verbrachte jeder Nutzer im Lauf des Monats dreieinhalb Stunden auf der Seite. Zeitnot sieht anders aus.
Dass Menschen überhaupt in Netzwerken kommunizieren, egal ob in analogen oder digitalen, führt der amerikanische Soziologe Charles Kadushin auf zwei unterschiedliche Motive zurück. Zum einen sucht jedes Individuum nach „support“ und „comfort“, nach Unterstützung und Wohlgefühl. Zum anderen treibt es immer auch Wettbewerb und Konkurrenz um. Wie sich Netzwerke entwickeln, so Kadushins These, hängt von der Art der Bindungen ab. Wo enge soziale Kontakte und direkte „Sichtbarkeit“ überwiegen, da setze sich eher der harmonisch-unterstützende Ton durch. Wo Anonymität und nur lose Bindungen vorliegen, geht es ruppiger, kämpferischer und machtorientierter zu.
Die großen Mitmach-Portale haben dieser soziopsychologischen Doppelstruktur längst Rechnung getragen. Während die sozialen Netzwerke auf die Wonnen der Nähe setzen, arbeiten andere Anbieter mit komplexen Systemen, um ihre Aktivistencliquen bei der Stange zu halten. Dabei spielen vor allem Rankings, also Wettstreit, aber auch interne Auszeichnungs- oder wechselseitige Belobigungssysteme eine große Rolle. Beispiel Amazon: Der mitteilungsbedürftige Privatkäufer kann hier Rezensionen zu allen verfügbaren Produkten einstellen. Diese Beiträge können dann wiederum von anderen Käufern bewertet werden: „35 von 48 Kunden fanden diese Rezension hilfreich.“ Aus der Gesamtzahl der Bewertungen und Bewertungsbewertungen stellt Amazon eine „Top-Rezensenten“-Liste zusammen – und schmückt damit die besten, fleißigsten unter den freiwilligen Helfern.
Die deutlich sichtbare Auszeichnung dient in letzter Instanz wieder dem eigenen Geschäftsmodell. Partizipation ist – auch im Netz – längst ein neues Wort für Kundenbindung geworden. Denn wer kommentiert und bewertet, ob bei eBay oder bei holidaycheck.de, der bleibt auch länger. Und je höher die Verweildauer, desto besser ist das auch für die Bannerpreise.
Das vermeintlich dialogische Prinzip ist dabei oft nur Mittel zum Zweck, meistens ist es eingebettet in eine neue Form von hierarchisierter Kommunikation. Die Plattformbetreiber stellen Information, Unterhaltung, Produkte oder Dienstleistungen zur Schau, der Besucher darf loben oder toben, in Waden beißen oder an Stiefeln lecken. Wo es zu krawalligen Kleinstmonologen in den Kommentarspalten kommt, sind sie bereits Teil des Gesamtamüsements. Das passive Massenpublikum konsumiert sie mit – und fühlt sich bei der Lektüre erst recht in seiner vornehmen Zurückhaltung bestätigt.
Erholung von den Marktschreiern des globalen Dorfs sucht man dann wieder im Privaten. Denn redselig, auch das belegt die ARD/ZDF-Studie, sind die meisten Nutzer durchaus – aber eben nur in den überschaubaren Gefilden des eigenen Bekanntenkreises. Der Deutschen liebste Onlineanwendung 2010? Es ist die gute alte E-Mail.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: