
© thyssenkrupp Corporate Archives, Duisburg
Das Fußball-Drama von Duisburg: Als Sepp Herberger nicht mehr auf dem Platz erschien
Vor 100 Jahren gastierte hierzulande erstmals die italienische Nationalmannschaft. Aus deutscher Sicht ging alles schief. Die Folgen des Spiels waren dennoch erfreulich.
Stand:
Wie er den Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen lässt und dann einen punktgenauen Pass zum Mitspieler schlägt, hat schon was! War das Sepp Herberger? Schwer zu sagen. Die Filmaufnahmen von einem sporthistorischen Spiel vor 100 Jahren geben dazu keinen Aufschluss.
Zu pixelig ist das zehn Minuten lange Bildmaterial, das im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde für Interessierte zur Verfügung steht. Produziert hat es die Westdeutsche Filmgesellschaft im Auftrag der Stadt Duisburg. Den Aufnahmen zufolge gab es an jenem Novembertag im Jahr 1924 nur eine Kamera, postiert war sie wohl nahe der Eckfahne.
Allzu viel ist daher nicht zu erkennen. Dennoch ist das Material ein beeindruckendes Zeugnis vom Fußball zu Zeiten der Weimarer Republik. Es zeigt vor allem eines: die Massen, die der Fußball damals schon für sich gewinnen konnte. Dicht aneinandergedrängt standen die Menschen auf den Tribünen.
Am 23. November 1924 spielte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien. Es war ein besonderes Spiel. Zum ersten Mal überhaupt traten die Italiener auf deutschem Boden an. Und zum ersten Mal war das Wedaustadion in Duisburg Austragungsort eines Länderspiels. Vor allem aber sollte das Spiel weitreichende Folgen für den deutschen Fußball haben.
Mussolini wurde zu einem Förderer der Sportart
Zu den Zuschauerzahlen gibt es unterschiedliche Angaben, laut dem Filmbeitrag aus dem Bundesarchiv befanden sich 25.000 Menschen auf den Steh- und 3840 auf den Sitzplätzen. In anderen Quellen wird von insgesamt 40.000 Zuschauern berichtet.
„Fußball hatte in der Weimarer Republik einen riesigen Stellenwert“, erzählt der Historiker und Journalist Erik Eggers. Die Rivalität zwischen den Fußballnationalmannschaften von Deutschland und Italien, die im Laufe der nächsten hundert Jahre anwachsen sollte, war dabei zu jener Zeit noch nicht besonders ausgeprägt.
Wenige Vereinsspiele hatten bis dahin zwischen den beiden Nationen stattgefunden. „Im Übrigen steckte der Fußball in Italien noch etwas in den Kinderschuhen“, sagt Eggers. „Und Benito Mussolini war noch nicht lange an der Macht.“
Mussolini sollte bald schon die Chancen des populären Fußballs für die Politik erkennen. Der Diktator wurde in den kommenden Jahren zu einem großen Förderer der Sportart, die in großen Teilen Europas lange als Fußlümmelei verspottet worden war. „Aber in den Zwanzigerjahren war das in Deutschland schon lange nicht mehr so“, erzählt Eggers. „Der Fußball war vor allem in den urbanen Räumen schon groß.“
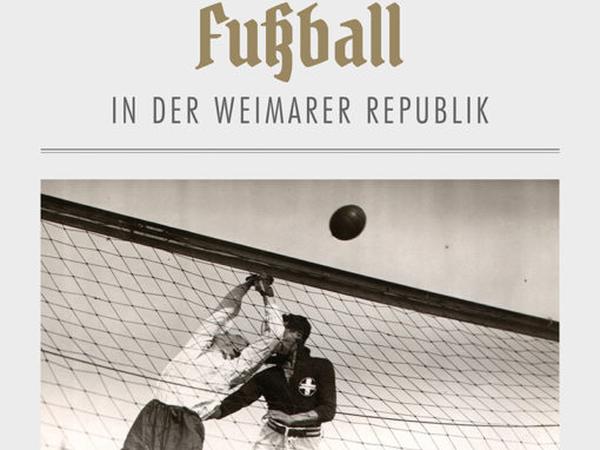
© Verlag Eriks Buchregal
Festmachen lässt sich das unter anderem an den Mitgliederzahlen im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1914 verzeichnete der Verband 190.000 Mitglieder, 1921 waren es bereits 750.000.
Auch das Medienecho auf die frühen Länderspiele ist ein deutliches Indiz für die Bedeutung des Fußballs. Das Spiel zwischen Deutschland und Italien vor 100 Jahren war ein großes Thema in den deutschen Zeitungen.
Demnach hatten die Deutschen unzählige Möglichkeiten liegengelassen und verloren das Spiel unglücklich mit 0:1. Vernichtend war die Kritik an der deutschen Mannschaft. „Wir hätten bei einigermaßen schußsicherem Innenstürmer das Treffen 3:1 oder 4:1 gewinnen können“, analysierte die zwischen 1921 und 1943 monatlich erschienene Werkszeitschrift „Das Werk“.
Herberger war ein Stürmerstar zu jener Zeit
Erik Eggers, Sporthistoriker und Journalist
Mit Innenstürmer war vor allem Sepp Herberger gemeint, einer der besten deutschen Fußballer zu jener Zeit. Doch Herberger hatte Pech in dem Spiel, nicht nur Schusspech. Zur zweiten Halbzeit musste er mit gebrochenem Arm ausgewechselt werden. Ein herber Schlag für die deutsche Mannschaft. „Herberger war ein Stürmerstar zu jener Zeit“, sagt Eggers. „Er galt als rustikaler Fußballer, gleichzeitig war er technisch versiert.“
Was für Herberger galt, traf aber nicht auf das gesamte deutsche Team zu. Einen Bundestrainer, der die besten Spieler auswählte, gab es nicht. Ein Spielerausschuss bestimmte den Kader. Dieser wurde nach Proporz zusammengestellt. Das heißt, jeder Regionalverband musste mit der Nominierung von Spielern aus dem eigenen Verband zufriedengestellt werden. Es war daher eine politisch bestimmte Mannschaft. „Die Spielstärke spielte kaum eine Rolle“, sagt Eggers.
„Die verhätschelten Söhne aus Süddeutschlands Hochburg“
Das sollte sich bald ändern. Ein Grund war auch besagtes Spiel gegen Italien. „Das Werk“ listete eine Presseschau zum Spiel auf. Darin stand unter anderem: „Es ist eine traurige Tatsache, dass der DFB-Spielerausschuss den Kanonen aus Nürnberg schon oft nachlaufen musste und nachgelaufen ist, wenn ein Spiel vor der Tür stand. (…) Die verhätschelten Söhne aus Süddeutschlands Hochburg sagten auch gegen Italien ab.“ Zum Verständnis: Die „Kanonen aus Nürnberg“ waren die Spieler des 1. FC Nürnberg, der mit Abstand besten Mannschaft in den Zwanzigern.
Offenbar war eine Berufung in die Nationalmannschaft für viele Spieler damals nicht das höchste aller Ziele. Die Presse kam jedenfalls zu folgendem Urteil: „Solange wir keine Mannschaft aufstellen, die nationalen Ehrgeiz in sich trägt und sich geistig und körperlich würdig auf das Ereignis einstellt (…), werden wir nie einen ehrlichen Erfolg erzielen.“ Und weiter hieß es: „In spielerischer Hinsicht ist gewiss manch Nürnberger nicht zu ersetzen, aber ehrlicher Wille, Opferbereitschaft und energisches Einsetzen der ganzen Kraft macht mangelndes Können bis zu einem gewissen Grade wett.“
Fußball war unter den Soldaten beliebt, vor allem deshalb, weil die Dienstränge keine Rolle spielten. Ob jemand Offizier oder einfacher Gefreiter war, war auf dem Platz egal.
Erik Eggers, Sporthistoriker und Journalist
Kampf, Opferbereitschaft – es sind dies die Zuschreibungen der deutschen Fußballnationalmannschaft mindestens bis in die Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Kriegsmetaphorik umwehte den deutschen Fußball. „Die Deutschen betreten den Kampfplatz“, lautete die Bildunterschrift zum Spiel gegen Italien in der Zeitschrift „Das Werk“. Die Begrifflichkeiten kamen nicht von ungefähr.
„Bereits im Ersten Weltkrieg wurde hinter den Frontlinien Fußball gespielt“, erzählt Eggers. „Fußball war unter den Soldaten beliebt, vor allem deshalb, weil die Dienstränge keine Rolle spielten. Ob jemand Offizier oder einfacher Gefreiter war, war auf dem Platz egal.“ Und wegen seiner Popularität sei der Fußball auch in die Militärausbildung integriert worden.
Zu jener Zeit aber reichte die Kampfkraft der Deutschen gegen die internationale Klasse anderer Mannschaften noch nicht aus. Die deutsche Nationalmannschaft galt Mitte der Zwanzigerjahre als drittklassig. Nach den Pleiten gegen Schweden und Ungarn (jeweils 1:4) war das 0:1 gegen Italien im Wedaustadion die dritte Niederlage in Folge. Der DFB geriet daraufhin immer stärker unter Druck und reagierte mit der Installierung von Otto Nerz im Jahr 1926 als „hauptamtlicher“ Reichstrainer. Nicht mehr Proporz, sondern Leistung bestimmte nun maßgeblich die Zusammenstellung des Kaders.
Doch gerade als die deutsche Nationalmannschaft immer besser wurde, brach sich eine anderer, gewaltiger und zerstörerischer Populismus Bahn: die nationalsozialistische Bewegung. Dunkle Zeiten brachen an, sie betrafen auch den Fußball, der in der Weimarer Republik noch aufblühte wie eine junge Pflanze.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- false