
© Stiftung Bauhaus Dessau
Hundert Jahre Bauhaus Dessau: Lass uns die Welt auf den Kopf stellen
Vor hundert Jahren entstand das Bauhaus in Dessau. Es revolutionierte Kunst, Design und Architektur. Das Jubiläum wird mit Ausstellungen und Partys gefeiert. Doch es drohen neue Gefahren.
Stand:
Ein monumentales Gebäude schwebend leicht aussehen zu lassen, das ist große Kunst. Von seiner Schauseite aus betrachtet wirkt das Bauhaus in Dessau wie ein Raumschiff, das gleich losfliegen könnte.
Die Glasfassade, die vor der Stahlbetonkonstruktion hängt, öffnet den Blick tief ins Innere. Einst arbeiteten dort die Studierenden auf drei Stockwerken in Werkstätten. Heute bewegen sich Besucherinnen und Besucher durch Museumsräume.
Vor hundert Jahren war ein Haus, das den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen schien, eine Sensation. Der Bauhaus-Direktor Walter Gropius, der es entworfen hatte, konnte dank der Zusammenarbeit mit Dessauer Unternehmen wie den Junkers Motoren- und Flugzeugwerken seinen Slogan „Kunst und Technik – eine neue Einheit“ verwirklichen.

© Stiftung Bauhaus Dessau
Das Bauhaus war gleichzeitig Schule und Fabrik, in ihm wurde entworfen und produziert. Seine Transparenz sollte als Sinnbild eines neuen, modernen und freien Lebens verstanden werden.
Die Anwendung des Glases, formulierte Gropius in konsequenter Kleinschreibung, „wird unbegrenzt sein und nicht auf das fenster beschränkt bleiben; denn seine edlen eigenschaften, seine durchsichtige klarheit, seine leichte, schwebende, wesenlose stofflichkeit verbürgen ihm die liebe der modernen baumeister“.
Allerdings war zu Gropius‘ Zeiten die Glasbauweise noch nicht ausgereift. Mit den Folgen haben die Nutzer des Bauhauses bis heute zu kämpfen. Die Fenster lassen sich schlecht gegen Kälte und Hitze dämmen, und der Kitt in den Ritzen zwischen den kleinen rechteckigen Scheiben verrottet schnell. Im Zweifel war dem Architekten Ästhetik wichtiger als Funktionalismus.
Vor hundert Jahren, im Herbst 1925, ist das Bauhaus von Weimar nach Dessau gezogen. Das Jubiläum soll ein ganzes Jahr lang gefeiert werden. Den Startschuss setzt ein Fest-Wochenende vom 5. bis 7. September, es folgen Ausstellungen, Theaterperformances, Konferenzen und Schulprojekte.
Seit 1996 gehören die Bauhaus-Gebäude in Weimar und Dessau zum UNESCO-Weltkulturerbe, ihre Strahlkraft reicht weit über Deutschland hinaus. Bis zu 150.000 Besucher werden in diesem Jahr in Dessau erwartet. Viele von ihnen kommen wegen des Bauhauses, der größten Attraktion der Stadt.
Flucht aus Weimar
„Es hat sich ausgeweimart, jetzt wird gedessauert“, witzelte 1925 der Maler Lyonel Feininger, der zu den Bauhaus-Meistern gehörte. Dabei geschah der Umzug keineswegs freiwillig, er glich einer Flucht. In Weimar, wo Walter Gropius 1919 das Bauhaus gegründet hatte, waren die radikalen Ideen der Künstler und Architekten auf Widerstand gestoßen.
Rechte, antirepublikanische Kritiker warfen der Hochschule von Anfang an vor, ein Sammelpunkt für „Kulturbolschewisten“ und von Juden dominiert zu sein. Ihre Werke wurden als „undeutsch“, „orientalisch“ und „kommunistisch“ diffamiert.
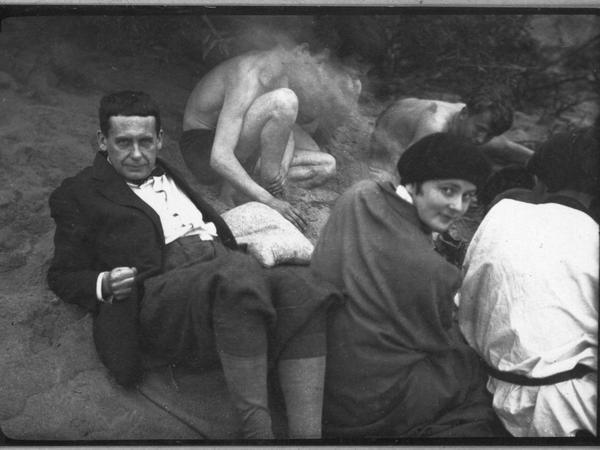
© Stiftung Bauhaus Dessau
Nachdem 1924 rechtsradikale und völkische Parteien die Thüringer Landtagswahlen gewannen und eine Regierung gebildet hatten, war klar, dass das Bauhaus in Weimar keine Zukunft mehr haben würde. Der Riss zwischen den Avantgardisten und den Anhängern einer völkischen, dem „Heimatschutzstil“ verbundenen Prämoderne war zu groß.
Der neue Kulturminister, ein deutschnationaler Hardliner, behauptete, das Bauhaus würde öffentliche Gelder verschwenden, und forderte die Schließung. Daraufhin verkündete Gropius die Auflösung der Institution.
Dessau bemühte sich um das Bauhaus und konnte sich gegen andere Städte wie Köln, die es ebenfalls bei sich ansiedeln wollten, durchsetzen. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der liberale Oberbürgermeister Fritz Hesse.

© Stiftung Bauhaus Dessau
Er fuhr nach Weimar, um mit Gropius zu verhandeln, und bot ihm eine Prämie, die er kaum ablehnen konnte: Eine Million Reichsmark für den Bau eines modernen Hochschulgebäudes. Heute wären das mehr als zwanzig Millionen Euro. Und Hesse versprach weitere Aufträge für Neubauten.
Dessau, bis 1918 Sitz des kleinen Fürstentums Anhalt-Dessau, war 1925 auf dem Sprung von einer kleinen barocken Residenz zur modernen Industriestadt. Fabriken wie die Motor- und Flugzeugwerke von Hugo Junkers boomten, die Bevölkerung hatte sich in wenigen Jahren beinahe verdoppelt. Die Einwohner brauchten Arbeit und Wohnungen.
Fritz Hesses Kalkül, dass bei beidem das Bauhaus helfen könnte, ging auf. Seine Investition zahlte sich aus. Denn in Gropius‘ Schule war die Trennung von Unterricht und Arbeit aufgehoben. Die Schülerinnen und Schüler im Bauhaus lernten nicht bloß wie in einer Schule, sie arbeiteten auch wie in einer Fabrik.
Mit den Prototypen, die sie herstellten, schufen sie Vorlagen für die industrielle Produktion in Dessauer Unternehmen, nicht nur für die Maschinen- und Flugzeugwerke von Junkers. Gropius und seine Mitarbeiter brachten den modernen Hochhausbau nach Dessau und schufen den dringend benötigten Wohnraum, zum Beispiel im damaligen Vorort Törten.
Die 350 Einfamilienhäuser, die dort von 1926 bis 1928 entstanden, erinnern mit ihren Vor- und Hintergärten an britische Reihenhaus-Arbeiterquartiere in London oder Manchester. Nur dass sie Flachdächer und Fensterbänder haben, ganz im Sinne des Neuen Bauens.
Arbeiterquartier mit Flachdach
Ästhetisch knüpft die Siedlung auch an Deutschlands erste Gartenstadt an, die ab 1909 in Hellerau bei Dresden entstand, und an die Hufeisensiedlung in Berlin-Neukölln, die von Bruno Taut und Martin Wagner ab 1925 verwirklicht wurde.
Die „chaotische uneinheitlichkeit unserer wohnungen“ beweise „die verschwommenheit unserer vorstellungen von der richtigen, dem heutigen menschen angemessenen behausung“, klagte Walter Gropius 1930. Er verlangte eine „grundlegende umgestaltung der gesamten bauwirtschaft nach der industriellen seite hin“. Industriell vorgefertigte Betonbausteine, entwickelt am Bauhaus, halfen, die Baukosten niedrig zu halten.

© Stiftung Bauhaus Dessau
Die Stadt Dessau drängte darauf, die Siedlung nach englischem Vorbild mit Eigentumshäusern zu bebauen. Eine Genossenschafts-Sparkasse vergab Kredite, die von den Bewohnern mit Monatsraten von 35 Reichsmark in 30 Jahren zurückgezahlt werden konnten. Das entsprach dem Drittel des Durchschnittseinkommens einer Arbeiterfamilie. So verwirklichte das Bauhaus die sozialistische Vision von bezahlbarem Wohnraum für alle.
Wer heute das Bauhaus in Dessau besucht, spürt Aufbruchstimmung und eine enge Verbindung mit dem aufrührerischen Geist der Gründerjahre. Touristen können dort übernachten, wo einst die Studierenden wohnten. Von den geschwungenen Stahlbetonbalkonen geht der Blick weit über den angrenzenden Hochschulcampus.
Die Zimmer sind mit Bauhaus-Betten, -Schreibtischen und -Stühlen möbliert. Und zum Duschen müssen sich die Besucher nun nicht mehr wie einst die Bauhäusler in den Keller begeben. Es gibt Duschen auf den Fluren. Allerdings handelt es sich bei dem Haus weitgehend um einen Neubau.

© dpa/Heidi Scharvogel
Große Teile des Bauhauses wurden bei einem Luftangriff am 7. März 1945 zerstört. Weil die Junkers-Werke Kriegsflugzeuge produzierten, gehörte Dessau zu den am meisten bombardierten deutschen Städten.
Nur die Grundmauern und wenige Räume blieben unversehrt, darunter das Direktorenzimmer von Walter Gropius. Dort hat man das Interieur rekonstruiert, mit Bauhaus-Stahlrohrstühlen und einem Nachbau des wuchtigen Schreibtisches. Das Original steht im Gropius House in Lincoln, Massachusetts.
Die DDR hat das Bauhaus lange bekämpft. Walter Ulbricht nannte es eine „Waffe des Imperialismus“ und erklärte den Bauhausstil zur „volksfeindlichen Erscheinung“. Der Modernismus passte nicht in das von der Sowjetunion vorgegebene Konzept des Sozialistischen Realismus und die Zuckerbäcker-Architektur der Stalin-Allee. Erst in der Ära von Ulbrichts Nachfolger Erich Honecker endete der Kulturkampf.
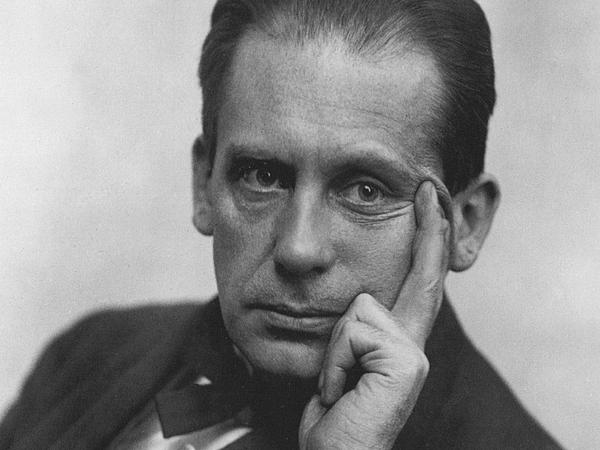
© Louis Held/Wikipedia
Viele Protagonisten des Bauhauses – daran erinnerte man sich nun auch in Ostdeutschland – sympathisierten mit dem Kommunismus. Und ohne die von ihnen erfundene industrielle Bauweise mit vorgefertigten Konstruktionsteilen hätte es die Plattenbausiedlungen der DDR nicht gegeben. So wurde 1976 das 50-jährige Bauhaus-Jubiläum in Dessau mit einer Ausstellung, der Gründung einer Stiftung und der Grundsteinlegung für den Wiederaufbau begangen.
In unmittelbarer Nähe des Bauhauses entstanden 1925 und 1926 die von Walter Gropius entworfenen Meisterhäuser. Die Stadt Dessau hatte die Grundstücke in einem Kiefernwäldchen zur Verfügung gestellt. Dort wohnten die Bauhaus-Professoren – allesamt Männer – in großzügigen, weiß verputzten Flachdachvillen zur Miete.
Bei einem Bombenangriff wurden drei von sechs Häusern zerstört, darunter das von Gropius. An seiner Stelle ließ eine Ärztin nach dem Krieg ein Haus mit Spitzdach errichten. 2015 wurde es rekonstruiert, allerdings so, dass Spuren der Vergangenheit erkennbar blieben. Die Fensterbänder an Gropius’ Villa bekamen Milchglasfüllungen. Nun wirkt das Gebäude wie ein blinder Fleck in der vorbildlich wiederhergestellten Siedlung.

© dpa/Hendrik Schmidt
In einem Meisterhaus residieren Stipendiaten, ein anderes wird von der Kurt Weill Stiftung genutzt. Die übrigen können bei Führungen besichtigt werden. Nicht alle Professoren umgaben sich wie László Moholy-Nagy oder Paul Klee mit Stahlrohrmöbeln aus der Bauhaus-Werkstatt.
Wassily Kandinsky, Pionier der abstrakten Malerei, holte altertümliche Möbel und sakrale Bilder in seine Unterkunft, die ihn an die russische Heimat erinnerten. Das Esszimmer ließ er komplett schwarz streichen. Später wurde es orange umgestaltet. Heute existiert noch ein goldener Fensterrahmen. Als hätte Kandinsky in einer Ikone wohnen wollen.
Die Nationalsozialisten haben das Bauhaus vehement bekämpft. Ihr Vordenker Paul Schultze-Naumburg nannte die Bauhäusler „Kulturbolschewisten“, die eine „Kathedrale des Marxismus“ bauen wollten. Im Kommunalwahlkampf forderte die Dessauer NSDAP-Stadtratsfraktion die fristlose Kündigung aller ausländischen Lehrkräfte und den „sofortigen Abriss“ des Bauhauses.
Dazu kam es nicht. Nach der Machtübernahme 1933 nutzten die Nazis die Hochschule weiter, zur Ausbildung von Handwerkern, für die Rüstungsproduktion und zeitweilig sogar als Gauleiterschule. Allerdings errichteten sie gleich neben dem Bauhaus eine Spitzdach-Wohnsiedlung im Heimatschutzstil. Den zentralen Platz benannten sie nach dem Freikorpskämpfer und Fememörder Albert Leo Schlageter.

© Stiftung Bauhaus Dessau
Hundert Jahre nach dem Baubeginn in Dessau hat das Bauhaus neue Gegner. Im Oktober 2024 sorgte die AfD im Magdeburger Landtag für einen Eklat. Sie stellte einen Antrag, der sich gegen die Kampagne „modern denken“ richtete, mit der Sachsen-Anhalt für die Ideen des Bauhauses wirbt.
Wettern gegen die Moderne
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hans-Thomas Tillschneider wetterte in seiner Rede gegen den „Irrweg der Moderne“ und warf dem Bauhaus vor, „das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit und Behaglichkeit (…) vergewaltigt“ zu haben.
Die „Altparteien“ hätten einen Narren gefressen am Bauhaus und dessen „Ablehnung des Einfamilienhauses“, „Internationalismus“ und „Ignorieren von Traditionen und Verwurzelungen“. Manche Passagen erinnerten an Reden von Adolf Hitler, der das „jüdisch-bolschewistische“ Bauhaus wegen seines „Internationalismus“ und „Kosmopoltismus“ angriff.
Barbara Steiner, die Präsidentin der Stiftung Bauhaus Dessau, fürchtet sich nicht vor der AfD. Noch nicht. Anders wäre das, wenn ein „AfD-Landeskulturminister zum Vorsitzenden unseres Stiftungsrats und die AfD auf Bundesebene regieren würde“, erzählt sie im Gespräch mit dem Tagesspiegel.
Eine Vorstellung, die nicht völlig abwegig ist. Im September 2026 wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag, und in aktuellen Umfragen liegt die AfD vorn.
Vor hundert Jahren hatte das Bauhaus wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Heute gibt es in Dessau viele Menschen, die das Bauhaus lieben.
Barbara Steiner, Präsidentin der Stiftung Bauhaus Dessau
Die AfD vertrete einen „nationalistisch-völkischen Kulturbegriff“, sagt Steiner und findet es „absurd, dass wir es hundert Jahre später mit demselben Wording zu tun haben. Die AfD veranstaltet ein Spektakel, aber es verfängt.“ Trotzdem bleibt die streitbare und schlagfertige Kunsthistorikerin optimistisch. „Vor hundert Jahren hatte das Bauhaus wenig Rückhalt in der Bevölkerung“, sagt sie. „Heute gibt es in Dessau viele Menschen, die das Bauhaus lieben“.
Mindestens 25 Bauhaus-Studierende wurden in einem KZ ermordet, darunter die Malerin Friedl Dicker-Brandeis, die Textildesignerin Otti Berger und der Architekt Naftali Anon. Doch die Moderne existierte im Nationalsozialismus subkutan weiter, in der Industriearchitektur oder im Flugzeugbau. Der Bauhaus-Schüler Franz Ehrlich gehörte zu einer kommunistischen Widerstandsgruppe, kam ins KZ Buchenwald und entwarf dort das Lagertor mit dem Schriftzug „Jedem das Seine“.

© Stiftung Bauhaus Dessau/Thomas Meyer, Ostkreuz
Wie Bauhäusler sich an das Regime anbiederten, das zeigt der vor kurzem erschienene Sammelband „...ein Restchen alter Ideale“. Herbert Beyer, zeitweilig der bestverdienende deutsche Werbegrafiker, entwarf Plakate für NS-Propagandaausstellungen wie „Deutsches Volk, deutsche Arbeit“ oder „Wunder des Lebens“.
Ludwig Mies van der Rohe, der das Bauhaus in Berlin bis zur Schließung durch die Nationalsozialisten leitete, trat in die Reichskulturkammer ein und unterschrieb einen Aufruf zur Unterstützung von Adolf Hitler. Im April 1933 traf er sich mit dem NS-Chefideologen Alfred Rosenberg, von dem er sich Unterstützung für die Wiedereröffnung des Bauhauses erhoffte.
„Der Kulturbolschewismus schreckt mich weniger als der Amerikanismus“, sagte er in dem Gespräch. Rosenberg zeigte sich aufgeschlossen für die Moderne, aber Hitler lehnte die Avantgarde der Weimarer Republik strikt ab. Beyer und Mies van der Rohe emigrierten 1938 in die USA.
Das Bauhaus Museum, 2019 in der Altstadt von Dessau eröffnet, zitiert mit seinem langgezogenen Flachdachbau und der Glasfassade die Architektur der Hochschule. 35.000 Objekte gehören zu seiner Sammlung, mehrere hundert davon sind in der Dauerausstellung zu sehen.
Als besonders lukrativ erwies sich die Webereiwerkstatt, in der nahezu ausschließlich Frauen arbeiteten. Ihre Teppiche und Textiltapeten, die von der Hannoverschen Tapetenfabrik Rasch & Co. ab 1929 produziert wurden, entwickelten sich zu Verkaufsschlagern.
„Wir strebten danach, uns zu vereinfachen, unsere Mittel zu disziplinieren, sie funktionaler und direkter nutzen“, hat die Textildesignerin Gunta Stölzl über ihre Zeit am Bauhaus gesagt. Aber noch wichtiger war etwas anderes: „Wir wollten nicht Künstler werden, sondern Menschen.“
- Adolf Hitler
- AfD
- Berlins Zwanziger Jahre
- DDR
- Hochschulen
- Köln
- Kunst in Berlin
- Mieten
- Nationalsozialismus
- Sachsen-Anhalt
- Schule
- Wohnen
- Wohnen in Berlin
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- false