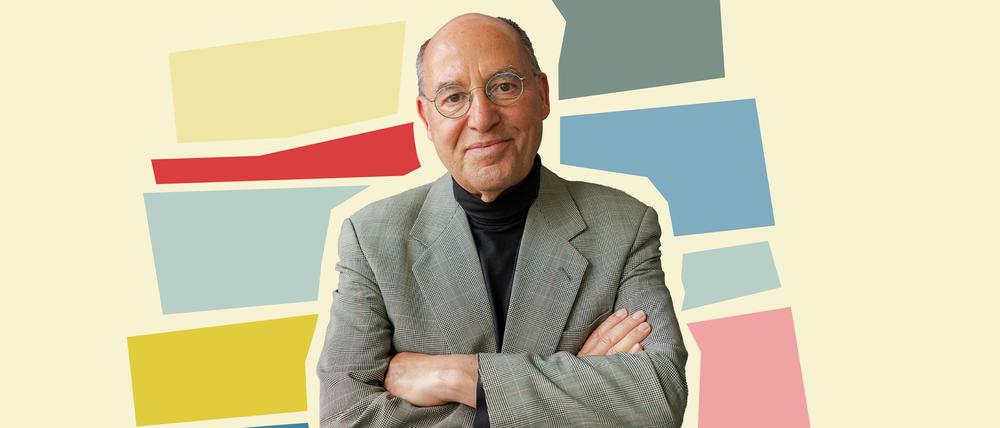
© Gestaltung: Tagesspiegel/IMAGO / Bonn.digital
Um Visionen für Berlin zu entwickeln, reicht es nicht, das Bestehende bestmöglich zu verwalten, wie es der aktuelle Senat – mehr schlecht als recht – tut. Mit dieser Selbstgenügsamkeit verliert unsere Stadt spürbar an Attraktivität und lässt die Potenziale verkümmern, sich als Metropole zu bestätigen, die mit Paris oder London in einem Atemzug genannt wird.
Wenn dann noch, wie gegenwärtig vom CDU-SPD-Senat, die Mittel, die eine Stadtgesellschaft zum Leben braucht, in einem dramatischen Maße zusammengestrichen werden, bleibt nicht mal mehr etwas von den „Basics“, die Kai Wegner zum Funktionieren bringen will. Denn so etwas zerstört die Bindungen der Bürgerinnen und Bürger an ihre Stadt.
Kürzungen zurückziehen
Mein Traum von Berlin in fünf Jahren besteht deshalb zunächst vor allem darin, dass sämtliche Kürzungen im Bereich der Bildung, im Bereich von Kunst und Kultur, im Bereich der Gesundheit und im Bereich von Wissenschaft und Forschung zurückgenommen werden. Berlin kann nur eine Metropole sein, wenn wir ein breites und hohes Kulturniveau ausstrahlen. Kinder und Jugendliche müssen bei uns einen chancengleichen Zugang zu Bildung und Ausbildung, zu Kunst und Kultur und zum Sport haben. Die Gemeinschaftsschulen sollten entwickelt werden. Kinder müssten mindestens bis zur 8. Klasse gemeinsam zur Schule gehen. All dies aber erforderte, dass beim Senat die Einsicht vorherrscht, gerade in diese Gebiete zu investieren.
Die vielfältige Kunst- und Kulturszene, die längst ein Markenzeichen für Berlin ist, muss sich weiter entwickeln können. Dass dort nun quasi zuerst gekürzt wird, zeigt die fehlende Bereitschaft, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was die Stadt ausmacht, wo der Reiz für viele ihrer Besucherinnen und Besucher liegt.
Grüne Oasen, nicht graue Betonflächen
Stattdessen liegt das Hauptaugenmerk des Senats darin, die Stadt überzogen autogerecht zu gestalten, also den begrenzten Stadtraum bevorzugt einem eher kleinen Teil der Stadtgesellschaft und des Umlandes zur Verfügung zu stellen und dafür Milliarden auszugeben. Sicherlich muss der Autoverkehr auch funktionieren, aber Übertreibungen sind nicht hinzunehmen.
Entwicklungen und Ansätze von Metropolen wie Paris, London oder New York, die – auch vor dem Hintergrund des Klimawandels – längst statt auf Betonschneisen und -flächen auf grüne Oasen setzen, werden einfach ignoriert. Dass wir in Berlin, wie in Deutschland generell, immer noch darauf setzen, manches originalgetreu wie vor 100, 200 oder 300 Jahren wieder aufzubauen, ist ein falsch verstandener Denkmalschutz. Als ob nicht zum Beispiel die Anpassung an viel höhere Temperaturen bedingt, dass wir Stadtplätze nicht mehr pflastern, sondern großzügig begrünen sollten. Selbstverständlich kann man solche Entscheidungen nicht dekretieren, sondern muss eine Verständigung in der Stadt organisieren und auch entsprechende materielle Voraussetzungen schaffen.
Bezahlbarer Wohnraum, Volksabstimmung, Entbürokratisierung
Das gilt ebenso für die Bezahlbarkeit des Wohnens, insbesondere innerhalb des S-Bahn-Rings. Auch in dieser Frage muss geklärt werden, ob die Stadt in ihren urbansten Räumen offen für Menschen aller Schichten bleibt oder die Innenstadt zum Eldorado wird. Hier muss die Stadt eine Vision entwickeln, die ihre Geschichte auch als Stadt der Mieterinnen und Mieter aufnimmt und zum Beispiel den gemeinnützigen Wohnungsbau zu einem Markenzeichen macht, wie es etwa in Wien geschehen ist.
Doch so lange praktisch mit jeder Abgeordnetenhauswahl Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt grundlegend verändert werden – eben weil es keine Verständigung bis hin zu einer Volksabstimmung darüber gibt –, so lange bleibt Berlin in den eigenen Verkrustungen stecken. Diese aufzubrechen, müsste die vornehmste Aufgabe einer Stadtregierung sein.
Eine Entbürokratisierung ist dafür dringend erforderlich. In weiten Teilen muss das Recht gedreht werden. Die Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen oder Einrichtungen müssen beweisen, wann sie bei der zuständigen Behörde einen Antrag gestellt haben. Wenn sie innerhalb von sechs Wochen keinen schriftlich begründeten Widerspruch erhalten, gilt der Antrag als genehmigt. Die Behörde muss beweisen, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller einen schriftlich begründeten Widerspruch erhalten hat. Anders ist eine Entbürokratisierung nicht hinzubekommen.
Vermittlerrolle in internationalen Konflikten
Neben der konkreten Gestaltung der Stadt, muss aber vor allem die Frage geklärt werden, wofür eine Metropole Berlin in der Welt stehen soll. Wowereits „Arm, aber sexy“ passte sicher gut in die Zeit, als Berlin langsam den Frontstadtschuhen entwuchs, aber für einen wirklichen Weltruf reicht es nicht. Eine Weltmetropole werden wir nur, wenn uns Menschen aus allen Kontinenten besuchen und hier Treffen, auch mit schwierigem Charakter stattfinden.
Wir könnten eine Begegnungsstätte werden, wo sich verfeindete Gruppierungen zum Zwecke der Verständigung begegnen. Wenn dies klug und geschickt und stillschweigend betrieben wird, wird unser Name weltweit an Bedeutung gewinnen. Berlin war während der Spaltung die Stadt des Konflikts, jetzt können wir die Stadt der Vermittlung werden. Das wäre auch vor dem Hintergrund des Verhaltens der Trump-Administration gegenüber den Organisationen der Völkergemeinschaft eine mehr als wichtige Vision, die zugleich eine historische Antwort darauf wäre, dass von Berlin der verheerendste Krieg der Menschheitsgeschichte ausging.
- BERLIN 2030
- Berliner Senat
- CDU
- Donald Trump
- Fahrrad und Verkehr in Berlin
- Gregor Gysi
- Jugend
- Kai Wegner
- Klimawandel
- Kunst in Berlin
- Mieten
- Mitte
- Schule
- Treptow-Köpenick
- Wohnen
- Wohnen in Berlin
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
