
© Getty Images/iStockphoto
Die Macht des Unsichtbaren: Was sich unseren Blicken entzieht, ist heilig oder teuflisch
Der Auferstandene, das Coronavirus oder andere Geistererscheinungen: Man kann sie nicht sehen, riechen oder anfassen. Gedanken über das Unsichtbare.
Stand:
Es ist ein Schock, das Grab ist leer. Er ist nicht hier, sagt der Engel des Herrn, und löst gleich ein Erdbeben aus. So steht es in der Bibel, ein paar Frauen werden ihm doch begegnen, auch einige Jünger und der ungläubige Thomas. Die Hohepriester verbreiten lieber das Gerücht, Jesus sei gestohlen worden. Der Auferstandene: eine Erscheinung. Der Rest ist Glaubenssache; die Christen feiern an Ostern die Macht des Unsichtbaren.
Eine Macht, die uns in der Corona-Krise ohnehin gerade äußerst bewusst ist. Auch das Virus kann man nicht sehen, nicht riechen, nicht anfassen. Die Hoffnung, die Gefahr, der Erlöser, die Krankheit, all dies entzieht sich den Blicken.
Ob der Messias oder Viren, Nanoteilchen, Gase, Radioaktivität: Das Unsichtbare ist heilig oder teuflisch, göttlich oder giftig, verborgene Allmacht oder mörderische Bedrohung.
Oft ist es schlicht winzig. Mit bloßem Auge bleibt einem die Welt der Moleküle verborgen; was kleiner ist als 0,15 Millimeter, unterläuft unser Fassungsvermögen. Oder es ist Lichtjahre weit weg. Der Mensch will es trotzdem beäugen, erfindet Hilfsmittel, das Teleskop für ferne Galaxien, das Mikroskop für Mikroorganismen. Manchmal ist das Unsichtbare auch nur rasend schnell. Zack, wusch, war da was?
Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:
- Interaktive Karte: Alle bestätigten Coronavirus-Infektionen nach Landkreisen und Bundesländern
- Bezirke, Infizierte, Verdopplungsrate: Die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin in Grafiken
- Am Coronavirus erkrankt oder nur Schnupfen? Was man über die Symptome weiß
- Tag für Tag: Auf unserer interaktiven Karte sehen Sie, wie sich das Virus global ausgebreitet hat
- Kampf gegen das Virus: Der Newsblog zur Pandemie in Deutschland und der Welt
Goethe fand, der Glaube sei die Liebe zum Unsichtbaren, Vertrauen aufs Unmögliche, Unwahrscheinliche. Oscar Wilde hielt dagegen: „Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren“, schrieb er im „Bildnis des Dorian Gray“. Ob Transzendenz oder Immanenz, das Virus ist keine Glaubensfrage, keine Einbildung, sondern Fakt. Die Erlösung davon lässt auf sich warten.
Wir sind nun mal Augenwesen, Sinneswesen. Wir möchten gucken, wahrnehmen, den Finger in die Wunde legen. Der Spruch von Antoine de Saint-Exupéry, demzufolge man nur mit dem Herzen gut sieht und das Wesentliche für die Augen unsichtbar bleibt, mag noch so beliebt sein: Wir wollen uns partout ein Bildnis machen. Aber wir dürfen oder können es nicht. Wegen des ersten Gebots, Gott stellt sich im Alten Testament als der Unvorstellbare vor. Und profaner, wegen der Konsistenz so vieler toxischer Substanzen: Asbestfasern, Giftgas, Elektrosmog, Strahlungsteilchen.
Die unsichtbare Gefahr: Das kennen wir von Tschernobyl
In einer der eindrücklichsten Szenen der Serie „Chernobyl“ blicken die Menschen staunend von einer Brücke aus auf den Feuerschein in der Ferne. Die eigentliche Gefahr bleibt unsichtbar und ist doch eingefangen. Keiner der damals realen Schaulustigen soll den GAU überlebt haben. Nach Tschernobyl verriet nur das Knacken der Geigerzähler etwas von der Zerstörungskraft der Radioaktivität. 1986 lernten wir Wörter wie Mikrosievert und Becquerel, wollten die geheime Gefahr wenigstens messen.
Mit Corona ist es genauso: Der Himmel ist klar, der Frühling schickt linde Lüfte, aber wer weiß, was tief im Rachen steckt. Infektiös, virtuell, viral, es ist nicht zu fassen. Wer infiziert ist, lässt nicht unbedingt Symptome erkennen, das verdoppelt die unsichtbare Gefahr. Ersatzweise starren wir auf Zahlen, auf steigende, abflachende Kurven. So ist es immer bei Seuchen: Die Statistik soll in den Griff bekommen, was sich nicht greifen lässt.

© Imago
Was unsichtbar ist, lässt sich nicht kontrollieren, deshalb macht es Angst. Davon profitiert das Science-Fiction-Genre seit H. G. Wells Klassiker „The Invisible Man“ von 1897. Nach einem missglückten Selbstversuch schafft der mad scientist es nicht zurück in die sichtbare Welt, traut sich nur verhüllt aus dem Haus, wird zum Dieb und zum Mörder. Viele Horrorfilme folgen dem gleichen Muster, von James Whales Romanverfilmung aus dem Jahr 1933 über Paul Verhoevens „Hollow Man“ bis zum Hightech-Thriller „Der Unsichtbare“, der Anfang des Monats auf Sky startete. Lauter Angstlustspiele. Wenn Steven Spielbergs „Weißer Hai“ am Ende aus dem Nichts auftaucht, dreht sich das Schockmoment um. Tödliche Neugier: Hilfe, das Monster ist mehr als nur Fantasie. Es ist leibhaftig hier.
Die Angstlust siedelt ja gern an der recht durchlässigen Grenze zwischen der physischen und der übersinnlichen Welt. Was wäre die schnöde Realität ohne den Grusel, das Unheimliche, die Fata Morgana, die Vision, die Halluzination? Trip und Tabu: ein Grusel, der in pandemischen Zeiten nichts Wohliges mehr hat. Da wünscht man sich glatt die heitere Variante herbei, und der Liedermacher Sebastian Krämer hilft einem mit seinem Song „Immer noch da, aber unsichtbar“. Die heimliche Schadenfreude, der Computerwurm, der Neumond, die anderen schönen Frauen außer der Liebsten, Insekten im Winter – wir sind umzingelt von temporären Abwesenheiten. Eben genau das: da, aber unsichtbar. Ähnlich sinnieren die Theologen über den abwesenden Gott. Selbst das Licht, solange es auf keine Reflexionsfläche trifft, ist so eine vermeintliche Unsichtbarkeit.
Wer sich unsichtbar macht, hat die Macht: Tarnkappen helfen
Allemal sind wir die Ausgesetzten. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich das Unsichtbare als immens politische Angelegenheit, von der Spionage über Feinstaubverschmutzung und den Krieg mit Biowaffen bis zum Opium Religion. Wer sich rar macht, hat die Macht. Wer es vermag, sich den Blicken der anderen nach Belieben zu entziehen (und über entsprechende Waffen verfügt), kann Weltherrscher werden. Davon künden schon die alten Griechen. Die Tarnkappe hilft Athene im Trojanischen Krieg; die Zyklopen statten den Unterweltgott Hades im Kampf gegen die Titanen mit einem Helm aus; Perseus kann Medusa gut getarnt den Kopf abschlagen.
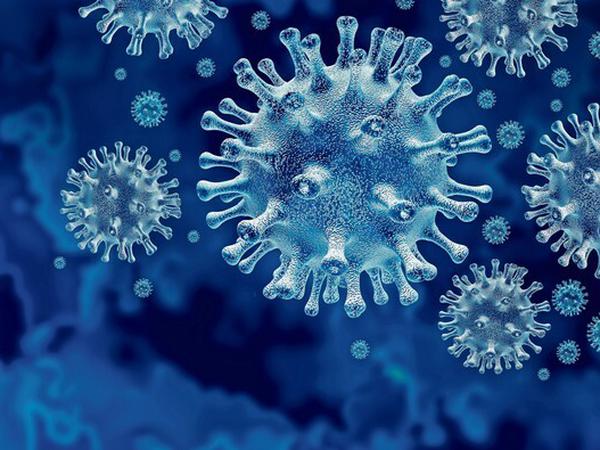
© Getty Images/iStockphoto
Auch bei den Nibelungen kommt die Tarnkappe zum Einsatz. Siegfried luchst sie Alberich ab – eigentlich ist eine Cappa gemeint, ein Umhang. Josef K. und der Landvermesser sind undurchschaubaren Bürokratien ausgesetzt: Franz Kafka, der Meister des Obskuren, hat mit „Der Prozess“ und „Das Schloss“ zwei der berühmtesten Parabeln auf die Ohnmacht vor dem Thron des Unsichtbaren verfasst.
Das amerikanische Militär testet seit Jahren Tarn-Prototypen, die QuantumStealth-Technologie macht’s möglich. Keiner sieht mich, und doch bin ich da, ein Faszinosum. Und ein archaischer Instinkt. Der Jäger und sein Opfer, der Räuber und die Beute, beide versuchen, sich zu verstecken. Schon kleine Kinder schließen die Augen und wähnen sich sicher. Die älteren lesen Harry Potter, der sich mit dem Tarnumhang, einem Familienerbstück, vor bösem Zauber schützt.
Wer ohne sein Zutun unsichtbar bleibt, ist umgekehrt vollkommen machtlos. Eine Studie der Initiative „More in Common“ von 2019 spricht vom unsichtbaren Drittel der deutschen Gesellschaft, zu dem die sozial Abgehängten, die Diskriminierten, Enttäuschten und politikfernen „Pragmatischen“ gehören. Es sind jene, die keine Lobby haben und nicht in der Öffentlichkeit auftauchen. Die Geschichte der Emanzipationsbewegungen lässt sich nicht zuletzt als Kampf um mehr Sichtbarkeit lesen. Die Übersehenen treten aus dem Schatten, ertrotzen sich Teilhabe. Den zugleich pathetischsten und irrlichterndsten Text über das Unsichtbare hat der Obrigkeits- und Religionskritiker Oskar Panizza geschrieben, ebenfalls 1897. In dem, was „Hunderttausende von Menschenseelen als brennenden Durst in ihrer Seele tragen“, machte er die Sprengkraft des verborgenen Volkszorns aus, den revolutionären Furor.

© Wikipedia Commons
„Ich bin ein wirklicher Mensch, aus Fleisch und Knochen, aus Nerven und Flüssigkeit – und man könnte vielleicht sogar sagen, dass ich Verstand habe. Aber trotzdem bin ich unsichtbar – weil man mich einfach nicht sehen will“, sagt der namenlose Held von Ralph Ellisons New-York-Roman „Der unsichtbare Mann“. Ein Schwarzer im Amerika der Nachkriegszeit: Der Icherzähler in diesem Hauptwerk der afroamerikanischen Literatur von 1952 haust im Kohlenkeller eines sonst nur von Weißen bewohnten Gebäudes, illuminiert sein Verlies mit abgezapftem Strom und blickt auf die Stationen seines Lebens zurück. Sie sind alle von Rassismus geprägt.
Corona und die Ausgangsbeschränkungen: Wir machen uns selber rar
Ausgesetzt, das sind auch die Aussätzigen, die aus der Gesellschaft weggesperrt wurden. Die Pest- und Leprakranken wurden auf Inseln verbracht, aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt, wegen Corona, ist jeder eine Insel. Wir sperren uns selber weg, um sicherzugehen. Und sehnen uns nach dem Verborgenen, dem Abwesenden, wie sich das Kind nach der Mutter sehnt, beim Freud’schen Fort-Da-Spiel. Wie die Frauen am leeren Grab.
[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]
Fort, alles fort. Bühnen, Kino- und Konzertsäle, Museumsgalerien, Technoclubs, auch die Kultur ist jetzt unsichtbar, den Blicken entzogen. In Hamburg wird unter dem Hashtag #keinerkommt. Alle machen mit für Mai das Nicht-Festival des Jahres annonciert.
Der unsichtbaren Gefahr begegnen wir, indem wir uns freiwillig in die Abwesenheit begeben. Wir machen uns rar – in der Hoffnung, eines nicht allzu fernen Tages wieder da sein zu dürfen. Es wird eine Feier der Anwesenheit.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: