
Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule feiert ihr zehnjähriges Bestehen.

Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule feiert ihr zehnjähriges Bestehen.

Vor 20 Jahren wurde am Peter-Szondi-Institut der Freien Universität Berlin die Samuel-Fischer-Gastprofessur für Literatur eingerichtet. Seitdem haben Hunderte Studierende die Gelegenheit genutzt, in Seminaren mit international bekannten Autorinnen und Autoren zu diskutieren.

Im Januar 2019 nehmen vier Exzellenzcluster ihre Arbeit an der Freien Universität an. Die Themen sind gesellschaftlich topaktuell.

Ein neues Verständnis von Literatur über Zeiten, Kulturgrenzen und Medien hinweg steht im Mittelpunkt des Clusters Temporal Communities.

Einst diente er dem Langzeit-Außenminister als Büroleiter. Heute ist Harald Braun Botschafter bei den Vereinten Nationen.

Der Deutsche Historikertag behandelt das hochaktuelle Thema „Gespaltene Gesellschaften“. Die Zunft streitet über Positionierungen gegen die extreme Rechte.

Ein konservativer Mann aus bürgerlichem Haus gerät in das Auswärtige Amt, das seine Vergangenheit beschweigt. Er macht da nicht mit. Er macht sich Feinde.

Von "Math+" bis zum Literatur-Projekt "Temporal Communities" ist Berlin mit sieben Clusteranträgen erfolgreich. Nur "Topoi" und "Shaping Space" fallen durch.

Schon die Jüngsten lernen, indem sie die Natur erforschen. Man sollte sich daher hüten, die Kindheit durch die Digitalisierung zu vereinnahmen. Ein Appell.

Die national-konservative Regierung setzt die Central European University (CEU) weiter unter Druck. Kurz vor Semesterstart wird der Teilumzug nach Wien geplant.

Geschlechtergerechte Sprache eröffnet geschützte Räume an der Universität. Der Erfahrungsbericht einer engagierten Professorin.

Neuer Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit: Die Orbán-Regierung will Geschlechterforschung an den Universitäten untersagen.

Bei einer Sommertour trifft der Regierende Bürgermeister im Lautarchiv der Humboldt-Uni auf einen Vorgänger - und dessen Vision von der wachsenden Stadt.

Wer sein Studium schmeißt, muss nicht verzagen. Hochschulen unterstützen Zweifler auf ihrem Weg in den Wunschberuf.

Zwischen Mao und Mephisto: Der Literaturwissenschaftler und Publizist Willi Jasper blickt auf die deutsche „Kulturrevolution“ von 1968 zurück.
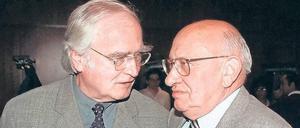
Zur Kenntlichkeit entstellt: Der Schlüsselroman hat keinen guten Ruf. Er gilt als indiskret. Literaturwissenschaftler Johannes Franzen erkundet seine Geschichte.

Die Historikerin Claudia Jarzebowski von der Freien Universität Berlin erforscht Familien der frühen Neuzeit, die in einer Fernbeziehung lebten.

Ein Wissenschaftler-Team der Freien Universität untersucht Ausdrucksformen der verletzenden Rede.

Berlin ist der Spitzenstandort der Wissenschaft in Deutschland: Das geht aus dem neuen Förderatlas der DFG hervor. FU und HU landen in den Top Ten der Unis.

Digitalisierung macht Kulturerbe global verfügbar. Doch politische Zensur und die Macht von Google stehen dagegen. Ein Gastbeitrag.

Dagmar Korbacher wird als erste Frau Direktorin des Kupferstichkabinetts in Berlin. Die Kunsthistorikerin möchte das Programm des Hauses digitaler machen.

Bedenken first: Der Literatur- und Medienwissenschaftler Roberto Simanowski schreibt in „Stumme Medien“ über die Gefahren der Digitalisierung.
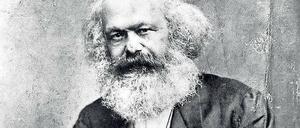
Marxanalyse, zeitgenössische Dramatik, Lesekreise: Das Festival Lit:potsdam tastet das Potenzial von Literatur ab.

Er ist einer der führenden Vertreter der postkolonialen Theorie: Der mit 100 000 Euro dotierte Gerda Henkel Preis geht an den Historiker Achille Mbembe.

221 Studierende haben an deutschen Universitäten das DAAD-Programm "Führungskräfte für Syrien" erfolgreich abgeschlossen.

Wie das Theater zum Drill wurde – und wie man sich dem widersetzt. Die Laudatio auf Benny Claessens, den Gewinner des Alfred-Kerr-Darstellerpreises.

Das Internet verändert die Wissenskultur - hin zu partizipativem, demokratischem Forschen. Die Prinzipien wurden schon seit den 1920ern entwickelt. Ein Gastbeitrag.

300 Tote bleiben pro Jahr unentdeckt in den Wohnungen liegen. In fast der Hälfte der Berliner Haushalte lebt nur eine Person. Doch das Bedürfnis nach Nähe ist enorm.
Potsdams Tag der Wissenschaften am Samstag will Lust machen auf Forschen, Mitmachen und Rätseln. Besucher erleben, wie Wissenschaft den Alltag prägt und verändert.

Der Mathematiker Günter M. Ziegler ist zum Präsidenten der Freien Universität Berlin gewählt worden. Im Interview erklärt er, was er mit der FU vorhat.

Geistes- und Wirtschaftswissenschaftler fühlen sich im Akkreditierungsrat nicht vertreten. Schuld sei die Hochschulrektorenkonferenz. Sie sei nach "Gutsherrenart" vorgegangen

Exzellent organisiert, erschwinglich, cool: Eine neue Begeisterung für die deutsche Hauptstadt wächst in der Welt. In Berlin dagegen überwiegt der Ärger über alltägliche Mängel. Wie passt das zusammen?

Winfried Engler war ein überaus engagierter Hochschullehrer und eine zentrale Figur im deutsch-französischen Austausch. Jetzt starb der Berliner Romanist im Alter von 82 Jahren.

Reinhard Rürup sah in der Erinnerungskultur einen Garant für die deutsche Demokratie. Nun ist der Historiker im Alter von 83 Jahren gestorben.

Wo der Baumwollkapselkäfer wütet: Die amerikanische Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing sammelt Geschichten für einen "Atlas der Verwilderung". Die Zeitschriftenkolumne

Schwebende Trümmer und Fetischobjekte: Anne Brannys' Buch „Eine Enzyklopädie des Zarten“ ist in der Galerie im Körnerpark zur Ausstellung geworden.

Die EU soll in ihrem neuen Forschungsrahmenprogramm mehr Geld für Geistes- und Sozialwissenschaften ausgeben. Das fordern 60 europäische Unis.

Zu Besuch im rumänischen Iași bei Cătălin Mihuleac, Autor des Romans „Oxenberg & Bernstein“ – die Übersetzung ist für den Leipziger Buchpreis nominiert.

Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig sammelt seit 1913 alles: von der Strickzeitung bis zum Blog, von Goethe bis Heino. Ein Besuch zur Buchmesse.

1968 war eine Zäsur in der deutschen Hochschulgeschichte - inhaltlich wie personell. Professoren erinnern sich.
öffnet in neuem Tab oder Fenster