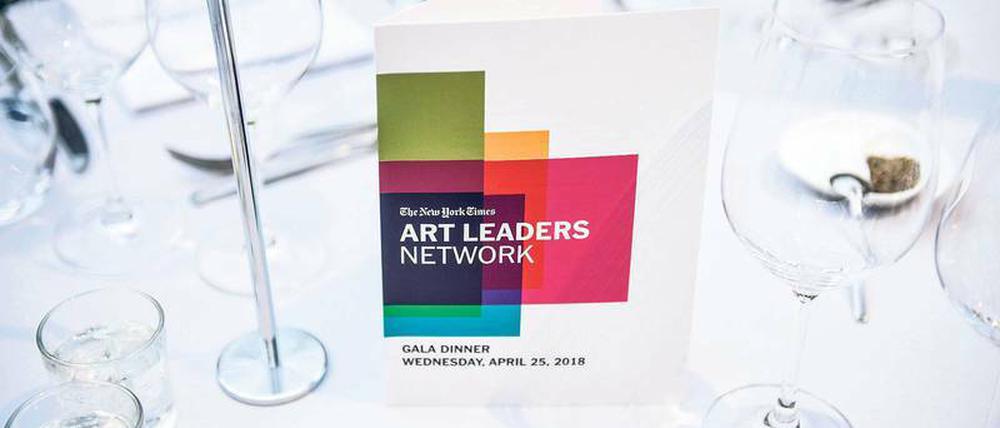
© New York Times/Flickr
Kunstwelt-Treffen in Berlin: Der Preis macht die Musik
Und wie verhindert man Missklänge? Die „New York Times“ lädt zum artleadersnetwork nach Berlin und offenbart dabei das Klassensystem in der Kunstwelt.
Stand:
Kommt ein Raumschiff geflogen, lässt sich nieder, dort wo die Berlin-Folklore die buntesten Blüten treibt, im „ewerk“ an der Wilhelmstraße zwischen Trabbifuhrpark und Checkpoint Charlie. An Bord eine Crew aus New York und London sowie die wichtigsten Protagonisten der internationalen Kunstwelt. Beim artleadersnetwork der „New York Times“ – mit röhrender Rhetorik als Gipfel der Innovatoren und Experten angekündigt – war zwar viel von Vernetzen die Rede, aber die Tagung vermied weitgehend die Begegnung mit Einheimischen.
Fundamentale Verschiebungen verunsichern auch den Bereich der Global Player auf dem Markt und in den Museen. Eine neue Generation von Sammlern wächst heran, zwischen Galerien und Auktionshäusern verschärft sich der Verdrängungswettbewerb. Und die Museen müssen ihre Sammlungskonzepte überdenken. 25 Jahre lang bestimmten Börsenspekulanten den Kunstmarkt als Käufer, sagt Marc Glimcher von der Pace Gallery. Jetzt ändert sich der Kundenkreis. Die Techies beginnen, Kunst zu sammeln. Pace eröffnete deshalb eine Dependance im Silicon Valley. Weil die neuen Sammler weniger an Statussymbolen interessiert sind als am Erfindungsgeist der Künstler, versucht die Galerie in Palo Alto direkte Begegnungen herzustellen.
Bei den Galerien weitet sich die Kluft zwischen großen und kleinen Häusern. Um für junge Galerien den Zugang zu den teuren Messen zu erleichtern, machte der Galerist David Zwirner einen Vorschlag, der zu einem leisen Beben führte. Er wäre bereit, für seinen Messestand mehr zu bezahlen, wenn das Geld jungen Galerien zugutekäme. „Das Galeriegeschäft“, sagte Zwirner, „war einmal kollegial und daran sollten wir uns erinnern.“ Unverblümt wies er auf eine Unwucht des Marktes hin. Junge Galerien bauen unbekannte Künstler sorgfältig auf. Aber wenn sich der Erfolg einstellt, wechseln diese zu einem der Megadealer. Und mit ihnen wandern die Käufer ab.
New Yorker Journalisten sprechen in Berlin mit New Yorker Galeristen
Marc Spiegler, Global Director der Art Basel, wirkte eher unlustig, über neue Bezahlmodelle zu sprechen. Flinker rechnete Elizabeth Dee. Die Galeristin gehört zu den Gründerinnen der Independent Art Fairs in New York. Wenn von 50 bis 60 Galerien ihrer Messe nur fünf bis sechs Händler 20 Prozent mehr bezahlen, könnte die Messe den Übrigen bis zu 14 Prozent Rabatt einräumen. „Das würden wir gerne machen“, sagte Elizabeth Dee. An dieser Stelle fiel allerdings auf, wie wenig junge Galeristen im Publikum saßen. Offenbar schreckte der Tagungsbeitrag von 1600 Euro viele ab.
Unter den Museumsdirektoren kursieren die Zauberworte „Geschichten erzählen“ und „sich verbinden“. Am klarsten drückte sich Tristram Hunt aus, Nachfolger von Martin Roth am Victoria & Albert Museum in London. Neben Blockbuster-Ausstellungen will er kleinere Museen mit Leihgaben und kuratorischer Expertise unterstützen. Seine Leidenschaft aber liege im Bereich der Bildung, sagte der Historiker, der zuvor Fernsehjournalist und Labour-Abgeordneter war. Weil an englischen Schulen Mittel für Kunstunterricht fehlen, will das V&A Designklassen anbieten. In den USA müssen die Museen wie in Berlin ihre westlich ausgerichteten Sammlungen überdenken. Stärker noch als in Europa sind sie dabei unter Druck, gesellschaftliche Konfliktlinien zu erspüren. 2017 erregte zum Beispiel Dana Schutz’ Gemälde eines aus rassistischen Motiven ermordeten Jungen Proteste bei der Whitney Biennale. Der weißen Künstlerin wurde vorgeworfen, schwarzes Leid auszunutzen.
Wunderlich wirkte, dass keine Kuratorin aus dem Hamburger Bahnhof, dem Berliner Museum für Gegenwart, zu der Diskussion eingeladen war. Dort streckt gerade mit „Hello World“ die Sammlung der Nationalgalerie ihre Fühler weit in die Welt aus und erzählt Geschichten. So fragte man sich, warum New Yorker Journalisten nach Berlin kommen, um mit New Yorker Galeristinnen und Museumsleuten zu sprechen. Aber die Presse sollte ursprünglich ohnehin in den Keller verbannt werden. Erst in letzter Minute durften auch die lokalen Berichterstatter nach oben zu den Herrschaften.
Die Künstler kamen zu kurz
Womöglich richtete sich die Konferenz gar nicht an ein Berliner oder New Yorker Publikum. Gründungssponsoren waren nämlich die Katar-Museen. In deren Kuratorium sitzt Ihre Exzellenz Sheikha al Mayassa bint Hamad bin Khalifa al Thani, die Schwester des Emirs von Katar und eine der mächtigsten Kunstsammlerinnen der Welt. Katar fährt eine zweigleisige Strategie. Dem Golfstaat wird vorgeworfen, den politischen Islamismus zu unterstützen, zugleich ist er ein Verbündeter der Vereinigten Staaten. In der National Vision für 2030 ist als Staatsziel verankert, dass das Emirat eine internationale Rolle in Kultur und Wissenschaft einnimmt.
Deshalb wird in Doha gerade mit Hochgeschwindigkeit eine Museumslandschaft angelegt. Der Neubau für das Nationalmuseum von Jean Nouvel soll mit leichter Verspätung im nächsten März eingeweiht werden. In Berlin habe sie gelernt, entschuldigt sich Sheikha al Mayassa, dass Bauen auch etwas länger dauern kann. In Planung ist außerdem die Art Mill, für deren Ausbau das Büro Elemental den Zuschlag erhielt, das Studio des chilenischen Architekten und Pritzker-Preisträgers Alejandro Aravena. Mit über 83 000 Quadratmetern wird die ehemalige Mühle wohl das größte Museum der Welt. „Wir wollen unsere Kultur und unser Erbe bewahren“, sagte Sheikha al Mayassa beim Gespräch auf dem Podium. Aber die 35-jährige Politikwissenschaftlerin stellt mit Hilfe von Kuratoren und Kunstberatern auch eine Sammlung westlicher Kunst zusammen. Zuletzt machte sie Schlagzeilen, als sie das Bild „Die Kartenspieler“ von Paul Cézanne für rund 230 Millionen Euro ersteigerte. In der „New York Times“ war die Schätzung zu lesen, die Katar-Museen verfügten jährlich über rund eine Milliarde Dollar Ankaufsetat.
Und die Künstler? Sie kamen zu kurz. Alicja Kwade hastete im Schnelldurchlauf durch ihr Werk. Olafur Eliasson informierte über seine Experimente mit sozialen Medien. Ai Weiwei kündigte an, dass er Berlin verlassen wolle. Und Jordan Wolfson, von David Zwirner als heißer Tipp empfohlen, verzichtete auf seinen Auftritt. Einen Tag zuvor hatte in der Stiftung Brandenburger Tor das Institut für Strategieentwicklung eine Studie zum Einkommen der Berliner Künstlerinnen und Künstler veröffentlicht. Es beträgt im Durchschnitt 9600 Euro im Jahr. So offenbarte diese Tagung vor allem eines – das Klassensystem in der Kunstwelt.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: