
Horst M. Teltschik zieht die Lehren aus der Überwindung der alten Systemkonfrontation zwischen Ost und West.

Horst M. Teltschik zieht die Lehren aus der Überwindung der alten Systemkonfrontation zwischen Ost und West.
Winfried Heinemann fragt nach den militärischen Optionen der Attentäter des 20. Juli.
Claudia Weber hat die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit nach dem Vertrag vom 23. August 1939 erforscht.
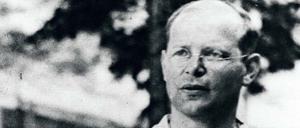
Wolfgang Huber zeichnet das Porträt eines Mannes, der Widerstand aus seinem Glauben heraus leistete.

Karl von der Heyden erinnert sich an das Wachsen der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben.
Eine Gespensterschule, Yosemite und der unheimliche Kinderhasser. Sechs Bücher, die auch Eltern gefallen.
Horst Gies folgt dem Auf- und Abstieg von Hitlers Landwirtschaftsminister Walther Darré.
Daniel Siemens erzählt die Geschichte der SA und betont ihre Bedeutung für die „Volksgemeinschaft“.
Nicht alle durften gehen
Günter Bannas blickt zurück auf vier Jahrzehnte deutscher Politik.

Angela Stent, Fritz Pleitgen und Michail Schischkin beschreiben den erneuten politischen Winter
Briefe aus dem Gulag

Der Historiker Lutz Raphael beschreibt in seinem Buch, was es bedeutet, wenn im Kapitalismus ganze Industrien stillgelegt werden.

Der Geschichtsforscher Martin Diebel beleuchtet in seinem Buch die Debatten um Ausnahmezustand und Notstandsgesetze von 1949 bis 1968.
Michela Murgia polemisiert – und zeigt dabei, wie leicht es ist, Faschist zu werden.

Mariana Mazzucato und Shoshana Zuboff schreiben die Wirtschaftsgeschichte des Westens fort.
Brendan Simms spricht über eintausend Jahre britisch-europäischer Beziehungsgeschichte.
Anne Applebaum schildert den „Holomodor“ in der Ukraine der dreißiger Jahre.

Wieland Wagner staunt über ein Land, das sich mit seinem allmählichen Abstieg abfindet

Wolfgang Benz lässt dem Widerstand in all seinen Facetten Gerechtigkeit widerfahren.

Thomas Karlauf schildert den Attentäter Graf Stauffenberg als Jünger und Vollender des George-Kreises.

Peter Frankopan ordnet das Projekt „Seidenstraße“ in die globale Politik ein.

Florian Meinel beleuchtet den Zustand des Parlamentarismus in Deutschland.

Felwine Sarr fordert echte Unabhängigkeit für den Kontinent und die Überwindung des Neokolonialismus.

Andrew Roberts und Ralf Georg Reuth beschreiben den Verlauf des Krieges - Roberts etwas mehr.

Seelisch deformiert: Andreas Petersen analysiert die Spitzenfunktionäre der frühen DDR.

Ian Kershaw beschreibt die europäische Geschichte seit 1950 als eine von Fortschritt und Gelingen. Eine Rezension.

Weniger Rechtfertigung als Erklärung des langjährigen Vertrauten von Kanzlerin Merkel

Andreas Rödder gibt Empfehlungen zum Verhalten in Europa.

Matthias Messmer und Hsin-Mei Chuang erkunden China an seinen Rändern

Ulrich Schuster beleuchtet Deutschlands Rolle in der Sicherheitspolitik.

Johannes Hillje will der antieuropäischen Propaganda begegnen In seinem Buch "Plattform Europa" erklärt er, wie die digitale Technik dabei helfen kann.

Dieter Langewiesche analysiert Europas Umgang mit dem Krieg – bis zur „humanitären Intervention“ von heute.
Jürgen Schmidt sucht die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung in der Zeit vor dem Kaiserreich.
Frank Sieren, Theo Sommer und Kai Strittmatter sinnieren über die künftige Rolle Chinas in der Welt.

Der englische Historiker Richard J. Evans beschreibt das „lange“ Jahrhundert der Dominanz Europas.

Auch ihr Charakterbild schwankt in der Geschichte: Dabei waren die Republik und ihre Verfassung wehrhafter, als ihnen meist nachgesagt wird.

Yuri Slezkine erzählt die Geschichte des Stalinismus am Schicksal der Bewohner des „Hauses der Regierung“.

Astrid Séville sieht in der vermeintlichen „Alternativlosigkeit“ ein Gift für die Demokratie.

Michael Hagemeister rollt den Berner Prozess um die „Protokolle der Weisen von Zion“ auf. Das Buch stammt von der russischen Geheimpolizei.

In der Defensive gewinnt man keine Debatten: Chantal Mouffe verteidigt den Kampf der Meinungen als Grundelement der Demokratie.

Wolfgang Schieder fragt nach der Vorbildfunktion des Faschistenführers Mussolini. Der kam bereits 1922 an die Macht.

Volker Ullrich schildert im 2. Band seiner Hitler-Biografie die dramatischen „Jahre des Untergangs 1939–1945“.

Peter Cornelius Mayer-Taschs Einführung "Kleine Philosophie der Macht" hilft bei diesen Fragen nur bedingt weiter.

Die Erwartungen an den Friedensvertrag überschritten jedes Maß. Deutschland sollte büßen – und wurde von den Siegern gedemütigt.

Die deutsche Revolution im November 1918 verlief ohne Plan. Und doch führte sie zu den Errungenschaften der modernen Demokratie.

Den Friedensnobelpreis bekam Willy Brandt für seine Ostpolitik. In seiner Nahostpolitik blieb er unter seinen Möglichkeiten, meint Michael Wolffsohn.
öffnet in neuem Tab oder Fenster