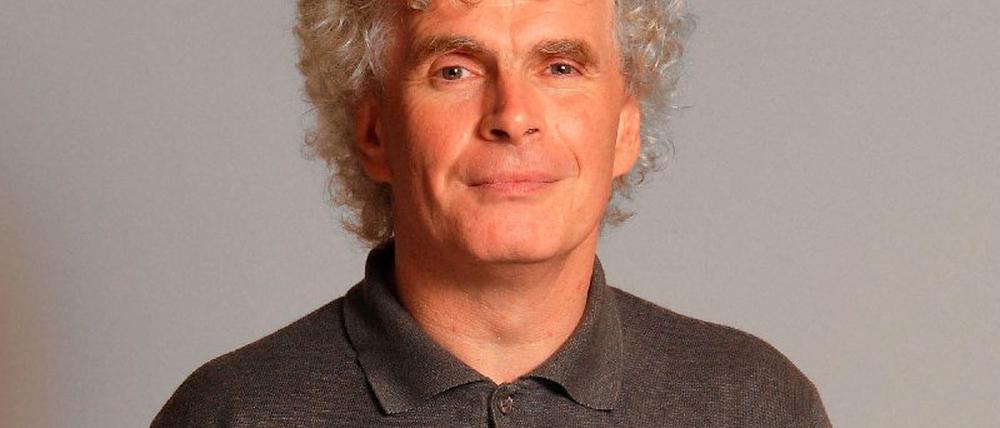
© Mike Wolff
Sir Simon Rattle: „Dieser Klang ist eine glühende Walze“
Um heikle Situationen zu lösen, macht Sir Simon Rattle schon mal einen Scherz. Anfangs dachten die Philharmoniker, sie dürften dann lachen.
Stand:
Sir Simon, was macht Ihr Deutschunterricht?
Ja, ja, mehr und mehr, vielleicht nicht besser, nicht fließend, aber ich versuche. Noch befinde ich mich allerdings nicht ganz auf der Avus der Sprache. Dafür ist mein Englisch in den letzten Jahren definitiv schlechter geworden. Vielleicht ein gutes Zeichen.
Wie fühlt sich das Deutsche in Ihren Ohren an, in Ihrem Mund und Rachen?
Sehr spannend, und das meine ich jetzt wörtlich. In dieser Sprache herrscht eine enorme dramatische Spannung. Ich liebe ihre Präzision. Ihre Entschiedenheiten. Ihren Hunger nach Bedeutung. Diesen absolut un-englischen Mangel an Nuancen und Zwischentönen. Und ihre grandiose unterschwellige Wildheit. Je länger ich in Deutschland lebe, desto überzeugter bin ich: Hier gibt es in den Wäldern noch Geister und Trolle, und die Menschen wissen das. Deswegen organisieren sie ja so viel, um diese Kräfte, diese Affekte, diese vielen ungebändigten Leidenschaften zu bannen. Als ich das begriffen habe, wusste ich, hier bin ich willkommen und zu Hause.
Sie pflegen auf dem Podium einen ausgesprochen engagierten, ja passionierten Dirigierstil. Ist das Neigung oder Notwendigkeit, Show oder Gefühl?
Ganz egal, ob Sie es mit Gustav Mahler oder mit Beethoven, mit Bach, Richard Wagner oder mit dem 21. Jahrhundert zu tun haben: Für Show ist kein Platz in großer Musik. Ich kann bei meiner Arbeit nicht ernsthaft darüber nachdenken, wie ich aussehe oder wirke, wem ich vielleicht gefalle oder nicht oder gefallen will. Und was das Gefühl betrifft, die Notwendigkeit: Es gibt in jedem von uns so etwas wie einen Dr. Jekyll und einen Mr. Hyde, wie Faust und Mephisto. Ich habe als junger Dirigent erst lernen müssen, mit der Ambivalenz zwischen dem Menschen Simon und dem Musiker Simon umzugehen. Das ist, als setzte die Musik in Ihnen ganz andere, ungeahnte Kräfte frei. Und diese Kräfte, glauben Sie mir, sind keineswegs immer angenehm oder sympathisch. Insofern existiert in diesem Beruf kein Als-ob.
Das klingt ein bisschen schizophren.
Es ist schizophren! Noch heute, wenn ich Filmaufnahmen mit mir sehe – das ist für mich regelmäßig ein Schock, der absolute Horror!
Aber Sie erkennen sich selbst darauf?
Sagen wir so: Ich erkenne den anderen in mir. Das bin ich, das bin ich eben auch! Aber eins weiß ich ganz sicher: Diese Seite der menschlichen Persönlichkeit hat im normalen Leben nichts verloren. Das wäre lebensgefährlich. Es sei denn, Sie entscheiden sich ausschließlich für die Musik, für die Kunst – und gegen jede Art von „vernünftiger“ Realität. Dann gelten Sie wahrscheinlich als verrückt, die Musikgeschichte ist voll von solchen Geschichten. Denn die Leidenschaften, die die Musik zu entfesseln vermag, sind so stark, niemand kann sich wünschen, mit ihnen wirklich zu leben. Sie sind nicht das Leben, sie erzählen uns etwas darüber. Das dürfen wir nicht verwechseln.
Wer ist Dr. Jekyll und wer ist Mr. Hyde in Ihnen?
Mal abgesehen davon, dass es so einfach niemals ist: Mr. Hyde ist wohl der Musiker. Wobei Sie nicht vergessen dürfen, dass ich auch Engländer bin. Wir sind sehr diskret, wir sind vor allem diskret im Umgang mit uns selbst. Wir können sehr ironisch sein, und wir wissen meist sehr schnell sehr genau, wann sich jemand selbst zu wichtig nimmt. Also vielleicht brauchen wir Engländer etwas länger, um uns unsere dunkleren Seiten einzugestehen – aber sie sind zweifellos da. Unter unserer Oberfläche sind wir ein sehr leidenschaftliches Volk, genauso leidenschaftlich wie die Japaner.
Dirigieren hat viel mit Kontrolle zu tun. Die 120 Musiker einer Wagner-Oper wollen doch nicht nur in Abgründe subjektiver Leidenschaft blicken, die wollen auch wissen, wo es langgeht und wie laut oder leise, wie schnell oder langsam sie spielen sollen.
Und das genau ist der Luxus der Berliner Philharmoniker. Dieses Orchester kann alles und will alles – und zwar von sich aus. Kein Dirigent der Welt muss diese Musiker motivieren oder erziehen. Das ist, als ob ein Geiger zum ersten Mal auf einem wirklich kostbaren Instrument spielt. Oder ein Reiter in den Sattel eines Araberhengstes steigt. Oder Sie plötzlich einen Zwölfzylinder fahren. Die Resonanz, die Sie als Gegenüber kriegen, ist überwältigend. Ich weiß, das sind Klischees, mehr oder weniger, aber es ist etwas Wahres dran. Wir – und jetzt sage ich bewusst „wir“ – können so viel wollen, wir sind so gierig und begierig, dass es manchmal fast zu viel wird.
Es hört sich jedenfalls riskant an, gefährlich.
Dass man etwas tun kann, heißt noch lange nicht, dass man es tun sollte. Die Potenz dieses Orchesters bringt wie jeder Reichtum eine große Verantwortung mit sich. Vor den Partituren. Vor den Musikern. Vor dem eigenen künstlerischen und menschlichen Gewissen.
Ist es dieses Potenzial, dieser Horizont an Möglichkeiten, der die Berliner angeblich zum „besten Orchester der Welt“ macht?
Ich finde es liebenswert, dass die Leute so etwas sagen. Und ich finde es fast noch schöner, dass dieses Etikett nichts bedeutet. Musik machen ist nicht wie Fußball spielen, bei uns gibt es keine Gewinner und keine Verlierer. Die Musik gehört dem Augenblick. Und der Augenblick ist flüchtig.
Wenn die Philharmoniker ein Fußballklub wären …
… dann natürlich einer mit ein paar sehr exzentrischen Spielerpersönlichkeiten und einer ehrwürdigen Tradition. Real Madrid vielleicht oder Juventus Turin, weniger wohl mein Heimatverein, der FC Liverpool. Was hält eine Mannschaft, ein Orchester im Innersten zusammen? Darüber habe ich viel nachgedacht. Ich denke, es ist die Idee eines kollektiven Gedächtnisses, nicht das Gedächtnis selbst, nein, die Idee. Die Berliner Philharmoniker sind heute ein außergewöhnlich junges Orchester, viele Musiker haben keine Vergangenheit miteinander. Und doch haben sie eine, und das ist das Geheimnis. Dieser Geist, diese Selbstverständlichkeit des Anspruchs.
Erinnern Sie sich an Ihr erstes Mal?
Oh ja! Mahlers Sechste, eins von Karajans absoluten Paradestücken. Der Klang des Orchesters ist wie eine glühende Walze über mich hinweggerollt, die haben gespielt wie im Konzert und überhaupt nicht wie bei einer ersten Probe. Und dann wollten sie wissen, was ich anders machen würde. Die waren neugierig auf den Unterschied, auf die Differenz, auf Korrekturen! Damit haben sie mir von Anfang an zu verstehen gegeben, dass es den philharmonischen Klang nicht gibt. Das hat mich tief beeindruckt. Und tut es noch.
Sind die Berliner Philharmoniker in Ihren Ohren ein deutsches Orchester?
Ist Berlin in Ihren Augen eine deutsche Stadt?
Nun ja …
Nun ja! Natürlich ist Berlin eine deutsche Stadt, bezeichnenderweise sogar die deutsche Hauptstadt. Aber es ist gleichzeitig auch eine Insel, immer noch, und ein hochspezieller Fall. Ein bisschen Goldgräberstimmung, etwas Größenwahn, die Schnelligkeit, die Ruppigkeit, der Humor, der Osten, der Westen, das viele Grün, das viele Wasser, Pinos sizilianische Delikatessen, all das macht, dass viele außergewöhnliche Menschen in dieser Stadt leben. Und das gilt in gesteigerter Weise für die Philharmoniker. Die sind süchtig nach exorbitanten Persönlichkeiten. Wo andere Orchester abwinken, zu schwierig, nicht integrierbar, da atmen die Philharmoniker auf.
Und all dies sind, noch einmal, deutsche Qualitäten? Der Klang, den diese Musiker aus 20 Nationen miteinander erzeugen, ist ein traditionell deutscher Klang?
Der „deutsche Klang“ ist für mich ein eher unglücklicher Begriff. Ich würde lieber von einer spezifisch deutschen Aussprache reden, von deutschen Betonungen und Akzenten. Die Aussprache eines Orchesters variiert von Stück zu Stück, von Dirigent zu Dirigent. Aber sein Wesen, sein Charakter, wenn Sie so wollen: sein Klang bleibt unverkennbar. Nehmen Sie Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajan, unterschiedlicher können zwei „deutsche“ Dirigenten nicht sein. Frei, flexibel und „voller Gemüt“ der eine, unerhört vital, exakt und technisch virtuos der andere. Beide haben die Philharmoniker maßgeblich geprägt. Und die Philharmoniker haben beide maßgeblich verkraftet.
Man hat Ihnen vorgeworfen, eben diese Prägung, diesen Klang aufs Spiel zu setzen. Durch Ihre Programmgestaltung, durch ihre Ästhetik, die sich dem ach so Schweren, Dunklen, Deutschen doch recht konsequent verweigert. Halten Sie diese Diskussion im Nachhinein für fruchtbar?
Als im vergangenen Jahr herauskam, dass Günter Grass Mitglied der Waffen-SS war, habe ich einen italienischen Freund gefragt, ob er die öffentliche Debatte übertrieben fände. Ja, hat er geantwortet, aber nicht für Deutschland. Das fand ich hilfreich.
Die Deutschen übertreiben gerne?
Sie sind gründlich. Sie sagen Ja und meinen Ja, sie sagen Nein und meinen Nein.
Hat es in Ihrer Arbeit mit den Philharmonikern Misserfolge gegeben, Krisen, Verstimmungen?
Ich wäre ein Masochist, wenn ich solche Dinge hier ausbreiten würde.
Eine sehr englische Antwort.
Eine sehr ehrliche Antwort. Und gleich noch etwas Ehrliches: Wenn Sie der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker sind, dann gibt es zu dieser Aufgabe keine Alternative. Auf der ganzen Welt nicht. Dessen bin ich mir sehr bewusst.
Welchem Ihrer legendären Vorgänger fühlen Sie sich am allernächsten, am herzlichsten verbunden?
Wer Wilhelm Furtwängler nicht liebt, ist hier definitiv fehl am Platz. Furtwängler – weit mehr als sein Antipode Toscanini! – hat das moderne Orchester geschaffen. Er hat Farben gefunden, Ausdrucksmöglichkeiten, die es im Orchesterspiel vor ihm so nicht gegeben hat. Und, ganz simpel, er konnte Übergänge gestalten wie niemand vor ihm und niemand nach ihm. Ein absolutes Wunder, ein Mysterium. Aber er hatte eben auch dieses Faustische. Der Mitschnitt der Beethoven-Neunten vom April 1942 aus der alten Philharmonie in der Bernburger Straße, das berühmte Konzert, an dessen Ende Goebbels ihm die Hand reicht: Eine solche Aufnahme können Sie nur in homöopathischen Dosen genießen. Das ist, als hätten Sie ein Bild von Francis Bacon über Ihrem Bett hängen.
Weil die Kunst hier an letzte Dinge rührt, an Grenzen stößt?
Weil sie plötzlich sehr viel mit dem Leben zu tun hat. Vielleicht mehr, als uns lieb ist. Ich weiß nicht, was Bruno Walter wusste, als er kurz vor dem Anschluss Österreichs an Nazideutschland 1938 in Wien Mahlers Neunte dirigierte, aber die Musik sagt, er und die Wiener Philharmoniker wussten eigentlich alles. Sie spürten, was da in der Luft lag. Propheten wider Willen.
Musik ist also immer auch politisch?
Im tiefsten Wortsinne von „politisch“, ja. Musik handelt von Menschen, vom Leben, von der Welt. Wir dürfen uns selbst nicht von ihr ausschließen. Ich weiß noch , an dem Abend, als die ersten Bomben auf den Irak fielen, spielten wir ein Konzert mit Haydns „Jahreszeiten“, und das Orchester hat mich gebeten, vorher etwas zum Publikum zu sagen. Haydn verhindert keinen Krieg, und die Berliner Philharmoniker dürften George W. Bush herzlich egal sein, aber wir können deutlich machen und müssen das auch, dass uns das Weltgeschehen etwas angeht. Warum sonst machen wir Musik? Denken Sie an meinen Freund Daniel Barenboim, mit wie viel Mut und Kraft er sich politisch engagiert, mit seinem West-Eastern Divan Orchestra, im Nahen Osten. Das ist nicht ganz unriskant.
Apropos Risiko: Besitzen Sie eigentlich so etwas wie eine Versicherung für Ihre Hände oder Ohren?
Hä? Nein, bis jetzt nicht. Aber wie alle Dirigenten plagen mich bisweilen Rückenprobleme. Früher habe ich dagegen Alexandertechnik gemacht und Tennis gespielt. Das hilft. Heute mache ich Sit-ups, fahre Fahrrad und dirigiere die Berliner Philharmoniker, die nehmen mir buchstäblich jede Last von den Schultern. Kennen Sie diese wunderbare Geschichte von André Previn und Leonard Bernstein? Nein? „Na, wie geht’s“, fragt Bernstein den Kollegen. „Ganz gut“, antwortet Previn, „wenn ich nur diese fürchterlichen Rückenschmerzen nicht hätte.“ – „Oh“, sagt Bernstein, „ich wusste gar nicht, dass du eine so große Karriere gemacht hast.“
Ein sehr englischer Witz.
Ein sehr amerikanischer Witz!
Gibt es eigentlich Tage oder Abende, an denen Sie müde sind, richtig erschöpft?
Mit über 50 hat man nicht mehr dieselbe Kraft wie mit 30 – außer man heißt Daniel Barenboim ... Mein Körper zwingt mich, mir mehr Zeit zu nehmen als früher, physisch strengt mich das Dirigieren heute mehr an. Aber der Sache selbst, der Musik bin ich nie müde, das ist ein vitaler Unterschied. Ich brauche jetzt mehr Zeit für mich, in der ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftige, in der ich reise, die Welt sehe, um meine Energiereserven wieder aufzuladen.
Ist Leidenschaft eine Frage der Haltung, der Lebenseinstellung? Dirigieren Sie mit derselben Inbrunst Beethoven oder Anton Webern, wie Sie Frühstück machen oder mit Ihrem zweijährigen Sohn spielen?
Schauen Sie, ich komme aus Liverpool, aus dem Norden Englands. Menschen aus Liverpool können Sie nicht fragen, wie viel Leidenschaft sie in ihr Frühstück stecken …
Wieso, was isst der Liverpudlian denn am Morgen?
No comment. Nein, ernsthaft, ohne Leidenschaft ist die Welt nichts. Und wer keine Leidenschaft aufbringt, ist im Grunde arm dran.
Fehlt Ihnen Ihre englische Heimat?
Die Sprache, ja, die vermisse ich manchmal. Weniger das englische Brot und auch nicht die Monarchie. Aber die Sprache. Und die Art, eine heikle Situation mit Humor zu bereinigen. Das weiß das Orchester übrigens inzwischen sehr gut zu lesen. Wenn Simon während der Probe einen Scherz macht, dann bedeutet das nicht, dass sich alle entspannt zurücklehnen dürfen, sondern ganz im Gegenteil, dass es etwas zu bewältigen gilt, eine Klippe zu umschiffen.
Und diese Scherze macht – Dr. Jekyll?
Absolut! Dr. Jekyll bereitet das Feld für Mr. Hyde. Und zwar auf Augenhöhe. Denn ohne Leben keine Kunst.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: