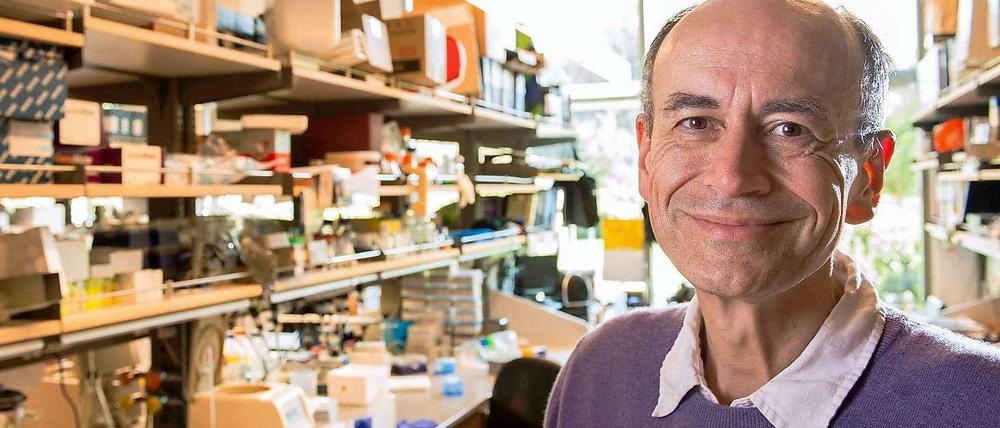
© Reuters
Medizinnobelpreis: Die Deutschen können Masse, die Amerikaner Klasse
Schon in den 80er Jahren ging der Nobelpreisgewinner Thomas Südhof in die USA. Lange Zeit galt das Land als erste Adresse für Spitzenforschung. Doch in jüngerer Zeit zog es viele Forscher wieder zurück nach Deutschland.
Stand:
Wir sind Nobelpreisträger! Der deutsche Mediziner Thomas Südhof hat sich mit seiner Zellforschung glanzvoll durchgesetzt. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Südhof forscht seit den achtziger Jahren in den USA. Lässt sich sein Triumph da für Deutschland vereinnahmen? Das hat sich vermutlich auch das Bundesministerium für Forschung gefragt. Es schickte am Montag lieber nur eine knappe Glückwunschmail herum. Wie schon im Jahr 1999, als der deutsche Günter Blobel den Medizinnobelpreis im Forschertrikot der USA gewann, steht die bange Frage im Raum: Hätte Südhof den Preis auch geholt, wenn er in Deutschland geblieben wäre?
Die Zeiten, in denen Deutsch die Wissenschaftssprache der Welt war, sind längst vorbei. Die Humboldt-Universität kann sich zwar in ihrem Hauptgebäude mit den Fotos von fast drei Dutzend Nobelpreisträgern schmücken. Doch die lebten vor allem in der Kaiserzeit, und seit 1956 kam niemand dazu. Heute geben die USA den Ton an. Auch deutsche Mediziner oder Naturwissenschaftler, die in der Forschung etwas werden wollen, brauchen in ihrem Lebenslauf den Stempel: „i.A.g.“ – „in Amerika gewesen“. Publiziert wird in Englisch, gerne in US-Zeitschriften.
Die Gründe für die amerikanischen Erfolge und wissenschaftlichen Durchbrüche sind vielfältig. Ein Professor in Stanford, wo Südhof inzwischen forscht, muss nicht im Schnitt 70 Studierende betreuen wie ein Professor der Humboldt-Uni. Natürlich haben die US-Spitzenunis enorm viel Geld, mit dem sie Wissenschaftler weltweit locken können. Auch sind Medizinprofessoren dort keine Halbgötter, sie sind für Ideen ihrer Doktoranden aufgeschlossen.
Trotzdem muss Deutschland sich nicht zu sehr sorgen. Es zeugt von der Qualität deutscher Unis, wenn ihre Doktoranden in den USA begehrt sind. Viele junge Forscher zog es übrigens zuletzt zurück nach Deutschland, weil die Finanzkrise die US-Unis zu massiven Einsparungen zwingt.
Im Nobelpreisranking der Fächer Medizin, Chemie und Physik stehen deutsche Wissenschaftler in den vergangenen 20 Jahren mit den Briten zusammen auf Platz zwei, mit je elf Nobelpreisen. Sieben bekamen Deutsche auch an deutschen Instituten. Die Nobelpreisschmiede Deutschlands ist inzwischen nicht mehr die Universität, sondern die außeruniversitäre Max-Planck-Gesellschaft. Hier läuft es so ähnlich wie in Stanford.
Dass Forscher an deutschen Unis kaum Chancen auf einen Nobelpreis haben, ist traurig – eine Ausnahme war 2005 der Münchner Physiker Hänsch. Trotzdem sind die USA kein Vorbild. Neben wenigen Spitzenunis gibt es eine Handvoll respektabler Forschungsunis. Die Masse aber kann mit den deutschen Unis nicht mithalten.
Mit Nobelpreisen für Deutsche darf weiter gerechnet werden, auch wenn heute der Nobelpreis für Physik und morgen der für Chemie verliehen wird.
Apropos Chemie: Den Chemieprofessoren der FU fallen seit Jahren gammlige Deckenteile auf die Reagenzgläser, Berlin will kein Geld für die Sanierung auftreiben. Kaiser Wilhelm hatte mehr Sinn für die Forschung.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: