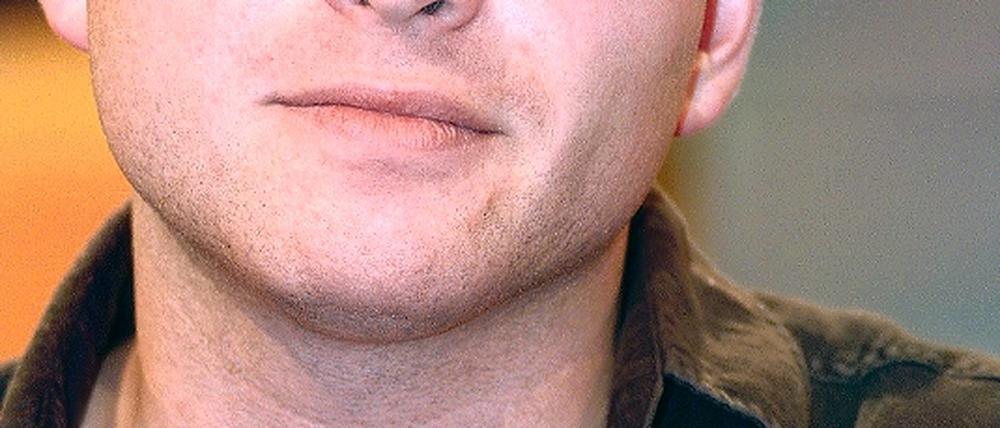
© picture-alliance
Fremdgänger in Chicago: Kristof Magnussons Banker-Roman
Den besten Witz hat Kristof Magnusson sich bis zum Ende seines neuen Romans „Das war ich nicht“ aufgehoben; einen Witz, über den vor allem die Buchbranche lachen dürfte, aber auch diejenigen, die glauben, dass Verlage und ihre Mitarbeiter betriebsblind sind und nur den Erfolg ihrer Autoren und Bücher im Sinn haben.
Da sitzt also das gesamte Romanpersonal nach allerlei Verwicklungen endlich einträchtig beim Sekt beieinander, der alternde amerikanische Schriftsteller, der gerade ein zweites Mal den Pulitzer-Preis bekommen hat, die junge deutsche Übersetzerin und der junge deutsche Banker. Und da stößt noch ein weiterer Verlagsmensch zu ihnen, ein Lektor, der schließlich in den Zeitungen nach ersten Meldungen über den neuen Pulitzer-Preisträger sucht. Nachdem er nichts gefunden hat, teilt er den anderen mit: „Steht nichts Weltbewegendes drin.“
Der Witz daran ist, dass die Welt gerade von der beginnenden Finanzkrise in Atem gehalten wird und einer der Protagonisten, der junge Banker, mittendrin steckt und kurzzeitig gar für den Auslöser der Krise gehalten und deshalb dringend gesucht wird. Weniger witzig ist, dass bis auf diesen Magnussons Witze eher flauerer Natur sind. Und dass überhaupt sich dieser Roman zwar anständig lesen lässt und man ihn problemlos als „flott“ bezeichnen könnte, er mit seinen betont komödiantischen Passagen und seinen zahlreichen Kolportage-Elementen aber auch Irritationen auslöst. Will der 33 Jahre junge Magnusson, der 2005 mit dem schönen Island- und Entwicklungsroman „Zuhause“ debütierte, wirklich über die Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten der Liebe erzählen, wie der Klappentext ankündigt? Oder „große Spannung“ erzeugen? Oder gar den Abgrund des Lebens darstellen, erzählen, wie schnell ein Leben (und eine Bank) komplett ruiniert werden kann? Diesen Eindruck macht die Geschichte nicht. Eher den einer hübschen Screwball-Comedy, für welche die Schicksale und inneren Verfasstheiten der drei Hauptfiguren nur Mittel zum Zweck sind. Das sind doch nicht wir!
Magnusson erzählt in kurzen Kapiteln jeweils aus der Ich-Perspektive von Meike, der Übersetzerin, Jasper, dem Banker, und Henry, dem Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger. Dabei muss man schon sehr aufpassen, wer gerade spricht, so austauschbar sind Gedanken und Impressionen der Figuren, so wenig gewinnen sie an Profil, an Eigenheiten. Meike Urbanski steckt in einer Lebenskrise. Sie hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, ist von Hamburg aufs Land gezogen – in ein verfallenes Haus in Deichnähe – und ernährt sich vom Übersetzen von Groschenheftchen. Henry LaMarck steckt auch in einer Lebenskrise. Er schafft es nicht, einen von ihm schon angekündigten Jahrhundertroman zu schreiben. Nach der Geburtstagsfeier zu seinem 60. Geburtstag in seiner Heimatstadt Chicago verkriecht er sich in einem Hotel, um weiteren Fragen nach dem Roman zu entgehen. Und Jasper Lüdemann, der Banker, ist ebenfalls nicht gerade glücklich, wiewohl er bei einer Investmentbank in Chicago eine ordentliche Karriere hingelegt hat und dort im Händlersaal große Summen bewegt.
Nachdem sich auch Meike auf den Weg nach Chicago gemacht hat, um LaMarck ausfindig zu machen, ihm seinen „Jahrhundertroman“ zu entreißen und ihn dann in Deutschland zu übersetzen, entwickelt Magnusson eine temporeiche, aber nichtssagende Dreiecksbeziehung mit viel Turbulenzen und verfehlten Verabredungen, an deren vorläufigem Ende die einsetzende Finanzkrise steht. Gefallen lässt man sich den Schauplatz Chicago, den Magnusson umsichtig und lebensnah beschreibt. Und auch die Vorfälle in Jaspers Bank, Jaspers schwer nachzuvollziehende Transaktionen, sein zwiespältiges Verhältnis zu den Kollegen. Das erinnert an andere Romane deutschprachiger Schriftsteller, in denen Banker oder Börsianer im Mittelpunkt stehen – eine Seltenheit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: an Ronald Rengs „Fremdgänger“ oder Konstantin Richters „Bettermann“. Den Irrsinn an der Börse, wie sich Menschen in der Abstraktheit von Zahlen verlieren, versteht Magnusson ganz schön abzubilden.
Das hilft jedoch nicht darüber hinweg, dass dieser Roman Weisheiten und Biografieausstattungen enthält, die in jedem Lifestylemagazin stehen: „Bis Anfang dreißig ist es einfach, normal zu sein. Alle Probleme kann man unter postadoleszenten Überspanntheiten verbuchen und sich bei jeder Krise damit beruhigen, dass irgendwann alles anders sein wird. Besser. Dann kommt das Alter, in dem einem jugendliche Verzweiflung nicht mehr steht. (...) Jenseits der dreißig entscheidet sich, ob der Mensch, der man geworden ist, für die restlichen fünfzig Jahre taugt.“ Da müssen sie durch, die Meike und der Jasper. Nur gut, dass Henry seinen Elton John hat, der die Vorzüge des Charitywesens in schönsten Farben ausmalt und ihm in London ein Plätzchen fürs Altenteil reserviert.
Es kommt dann doch alles anders, als man denkt, um in der Rhetorik von Magnussons Figuren zu bleiben, und am Ende hat man einen mäßig vergnüglichen Unterhaltungsroman gelesen, dem es wie seinem letzten Witz geht: kaum erzählt, kaum fertig gelacht, schon vergessen. Steht halt nichts Weltbewegendes drin.
Kristof Magnusson: Das war ich nicht. Roman.
Kunstmann-Verlag, München 2010.
288 Seiten, 19,95 €.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false