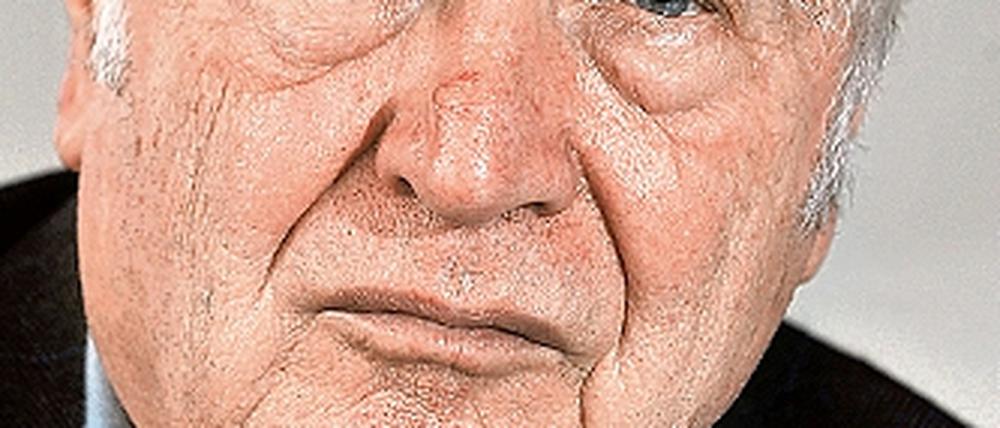
© dpa
Martin Walser: Allein die Schönheit zählt
Glaube, Liebe, Worte: Martin Walser schreibt in seiner Novelle „Mein Jenseits“ vor allem für sich selbst
Bevor es losgeht in seinem neuen Buch „Mein Jenseits“, spricht Martin Walser eine Warnung aus: an die Leser, nicht zuletzt an die professionellen Kritiker unter ihnen. Platziert hat er diese in einem Zitat des beliebten, im 16. Jahrhundert lebenden und tätigen Mystikers und Philosophen Jakob Böhme: „Wer es verstehen kann, der verstehe es. Wer aber nicht, der lasse es ungelästert und ungetadelt. Dem habe ich nichts geschrieben. Ich habe für mich geschrieben.“
Das geht natürlich nicht so einfach, wie Walser sich das vorstellt, ist doch „Mein Jenseits“ seit heute in der Welt und will nicht nur annonciert („Der neue Walser ist da!“), sondern durchdrungen und gelobt oder getadelt werden. Dass aber Walser nur noch für sich selbst schreibt und sich auch sonst um wenig schert, das merkt man diesem Buch tatsächlich an, inhaltlich und an den Umständen seiner Veröffentlichung. Denn erschienen ist es nicht bei Rowohlt, Walsers Verlag seit seinem Weggang von Suhrkamp 2004, sondern in dem kleinen Berliner Verlag Berlin University Press. Dessen Verleger Gottfried Honnefelder kennt und schätzt Walser noch aus seligen Suhrkamp-Tagen. Er dürfte mit dem Überlassen dieser Novelle einen Freundschaftsdienst geleistet haben – ungeachtet der Tatsache, dass schon im März bei seinem Stammverlag der dritte Band seiner Tagebücher veröffentlicht wird. Zudem ist „Mein Jenseits“ lediglich ein Auszug aus einem neuen Roman mit dem Arbeitstitel „Muttersohn“, der 2011 ebenfalls bei Rowohlt erscheint. Aber ein bisschen Fremdgehen muss selbst im hohen Alter sein. Man kennt das von Walser. Schon früher bei Suhrkamp überließ er der kleinen, in Eggingen/Baden-Württemberg ansässigen Edition Isele immer wieder mal ein Büchlein, sehr zum Unwillen Siegfried Unselds.
Doch Romanauszug hin, nur für sich schreiben her: „Mein Jenseits“ ist Walser skurrilstes, komischstes und philosophischstes Buch seit langem. Ein typisches Walser-Buch mit typischen Walser-Sätzen und typischen Walser-Themen: Liebesversuche, Konkurrenzverhältnisse, Schönheitsdiskurse, Alter und Tod. „Mein Jenseits“ soll eine Novelle sein, doch es ist alles andere als stringent durchgeschrieben, steckt voller Einschübe und Gedanken. Die unerhörte Begebenheit, ein Reliquienklau, kommt erst am Schluss: „Jetzt die Handlung“, beginnt das vorletzte Kapitel schön dreist und unvermittelt. Kurzum: ein großer Spaß, der dennoch mit viel Ernst geschrieben ist. „Je ernster ich den Prozess gegen mich betreibe“, weiß der Ich-Erzähler, „desto unernster meine ich es“. Und er schlussfolgert: „Je ernster einer den Prozess gegen sich betreibt, desto mehr wird daraus Ironie.“
Es beginnt mit Einlassungen über das Komischwerden im Alter, über einen Knecht, der nicht mehr in seiner Kammer schläft, sondern auf dem Heuboden, und nicht mehr spricht, höchstens mit Forellen. Der Knecht ist der Gewährsmann für den gleichfalls an sich Anzeichen von Kauzigkeit feststellenden Helden: Augustin Finli, Chefarzt des Psychiatrischen Landeskrankenhauses in Scherblingen. Finli befindet sich irgendwie in seinen sechziger, vielleicht gar siebziger Jahren, nach seinem 63. Geburtstag hat er mit dem Zählen aufgehört. Er steht kurz vor seiner Ablösung im Krankenhaus. Sein Nachfolger, Dr. Bruderhofer, kann die Ernennung zum Chef nicht abwarten und scharrt offensiv-aggressiv mit den Hufen: „Er macht mich herunter, wo er kann. (...) Er will mich in der Zeitung lächerlich machen. Seine Neuroleptika gegen mein Johanniskraut.“
Da kann einer schon mal komisch werden und über das Leben an sich, die Liebe und vor allem den Glauben räsonieren: den Glauben im Speziellen, den katholischen und den Glauben im Allgemeinen, den eher philosophischen. Es folgt eine Reise Finlis nach Rom, wo er wie bei jedem Rombesuch die Basilika des Heiligen Augustin aufsucht und ein Madonnenbild von Caravaggio bestaunt, insbesondere die Schönheit der Madonna und die zweier Pilger: „Allein die Schönheit zählt. Das Jenseits muss schön sein. Sonst kannst du es gleich vergessen. Nur wenn es so schön erscheint wie in der Basilika, füllt es dich aus bis zur Fraglosigkeit.“
Und es folgt ein Exkurs in die Geschichte der Scherblinger Stiftskirche, das Ansinnen Finlis, Kirchendiener zu werden, die Erinnerung an eine alte Liebesgeschichte (aus der der Chefarzt-Kandidat Bruderhofer als Sieger hervorging), eine seltsame Silvesterfeier und schließlich der Diebstahl des „Heiligblut-Kreuzes“, der Finli unweigerlich zu seinem und Walsers Grundthema führt: Glauben. An die Liebe. An die Wörter. An die Sprache. So weiß Finli angesichts der vier roten Rubine auf dem Kreuz: „Wissen, dass das Blut nicht echt ist, aber glauben, dass es echt sei, das wäre das, was die Reliquie zu einem unvergänglichen Schatz machen würde.“
Eingebungen wie diese sind, über das ganze Buch verstreut, Sätze wie „Glauben, was nicht ist. Dass es sei“ oder „Glauben lernt man nur, wenn einem nichts anderes übrig bleibt“. Deshalb erinnert „Mein Jenseits“ passagenweise mehr an „Meßmers Gedanken“, die biografisch inspiriert waren, als an Walsers vom Verlag im Klappentext so sehnsüchtig herbeizitierte Erfolgsnovelle „Ein fliehendes Pferd“. Es sind eben sicher auch eigene „Seelenverhältnisse“, denen Walser wieder einmal nachspürt. Das lässt man sich gefallen, selbst wenn nicht jede der „Wörterschlendereien“ Walsers nachvollziehbar und verständlich ist. Man muss schließlich nicht immer alles verstehen, um Vergnügen daran zu finden.
Martin Walser:
Mein Jenseits. Novelle. Berlin University Press, Berlin 2010. 119 Seiten, 19,90€.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false