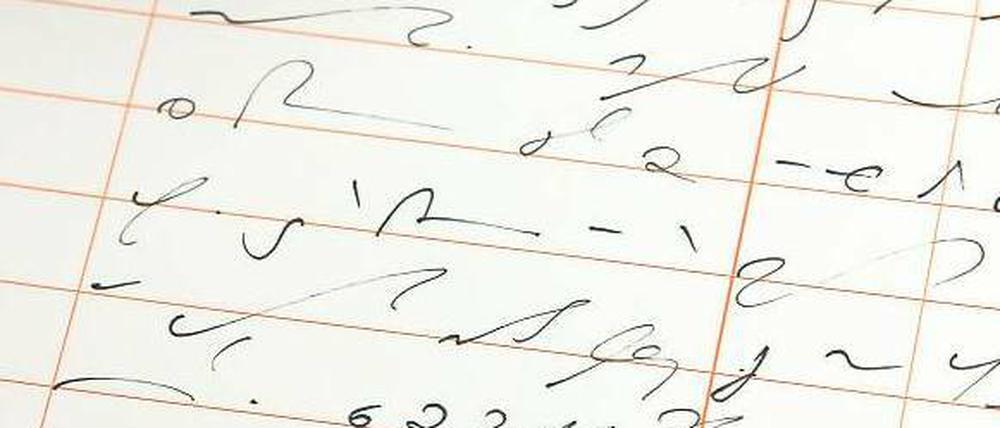
© picture-alliance/ dpa-tmn
Politik: Komplizin der Macht
Kaffee kochen? Nett sein? Das war einmal. Längst ist die Sekretärin zur heimlichen Führungskraft aufgestiegen
Niemand soll denken, man wäre eine „Tippse“. Eine, die den Kaffee holt und Briefe schreibt. Eine, die dem Chef nach dem Mund redet, die verstummt, wenn er das Zimmer betritt, als hätte er sie bei etwas Unanständigem erwischt. „Ein Gespräch über den Beruf der Sekretärin?“ Am anderen Ende der Leitung wird es still. „Nein danke, kein Interesse.“ Die Dame im Sekretariat einer Kölner Bürofachschule legt einfach auf.
Es ist das Wort. „Sekretärin“, sagen Sekretärinnen, das klinge verstaubt und altertümlich. Es lasse die Leute an Flanell und beflissene Diktate denken. Und an blöde Witze. Ruft eine Sekretärin ständig nach dem Mechaniker. Ihre Schreibmaschine sei kaputt. Immer diese Lücken zwischen den Buchstaben! Der Mechaniker schickt das Fräulein nach draußen, schraubt den Bürostuhl vier Zentimeter höher, gerade dass die Brüste nicht mehr die Leertaste drücken. Das Fräulein staunt ergriffen. „Mein Gott, wie geschickt Sie sind!“
Sekretärinnen von heute, die keine Sekretärinnen mehr sind, haben höchstens deshalb nichts dagegen, so genannt zu werden, weil sie wissen, was sie können. Man sollte trotzdem aufpassen und auch die frisch gekürte „Beste Sekretärin Deutschlands“ nicht „Sekretärin“ nennen: Alexandra Friedhoff, 42, kommt aus Berlin und arbeitet beim Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Im Finale des Wettbewerbs vor drei Tagen setzte sie sich gegen acht verbliebene Konkurrentinnen durch (von ursprünglich 250). Was Friedhoff besonders gut konnte? Einen Absagebrief der Bundeskanzlerin für die Hochzeit von William und Kate in englischer Sprache formulieren ...
Wie die meisten ihrer Kolleginnen würde Friedhoff sich eher als Management-Assistentin bezeichnen. Und wie viele Begriffe es sonst noch gibt! Die Team-Assistenz, die Assistenz der Geschäftsleitung und die des Vorstands, das Back-up-Office, die Büroleitung und überhaupt den ganzen Komplex des Office-Managements. Vielleicht, dass man sich für den Anfang darauf einigt, dass sich im Büro eine Menge verändert hat.
Alexandra Friedhoffs Vorgängerin Catherine Fuchs ist 31 und arbeitet als persönliche Assistentin Markus Lessings, seines Zeichens Geschäftsführer der DeutschlandCard GmbH. Sie duzt ihren Chef, kennt seine persönlichen Daten, inklusive aller Kreditkartennummern. Sie organisiert Reisen, optimiert, entscheidet über die Planung der Geschäftsführertreffen, sie weiß, wo es den besten Wein gibt, die witzigsten Geschenkideen. Ursprünglich kommt sie aus der Hotellerie, was in der Branche als extrem vorteilhaft gilt. Der Flexibilität, der sicheren Umgangsformen, der hohen Belastbarkeit wegen. Man hat schnell zu sein und repräsentabel. Man muss einen unangreifbar souveränen Ton treffen. Einen Ton, der höflich, zuweilen herzlich klingt – als sei kein Problem denkbar, als gäbe es kein „Puzzle“, das nicht jederzeit neu zu lösen sei.
Beim Sekretärinnen-Wettbewerb des schwäbischen Büroartikelherstellers Leitz geht es um Persönlichkeit, Schnelligkeit, Allgemeinwissen, Organisations- und Improvisationstalent. Sicher gibt es noch irgendwo Chefs, die keinen Computer haben und E-Mails nur ausgedruckt lesen. Und bestimmt gibt es auch noch Assistentinnen, die stenografieren können. Viel mehr aber ist vom alten Berufsbild nicht übrig geblieben. Ein Verlust? Ein Gewinn?
Bei Frauen wie Catherine Fuchs oder Alexandra Friedhoff kommt man gar nicht erst auf die Idee, sie nach den Schattenseiten zu fragen. Was tun Sie, wenn Sie älter, was, wenn Sie mal krank werden? Können Sie, wenn Sie das möchten, eine Familie gründen, solange von Ihnen wie selbstverständlich erwartet wird, dass Sie auch nachts um zwei noch Präsentationen schreiben? Glauben Sie an eine Zukunft in diesem Job?
Es ist jedenfalls nie das eigene Puzzle, das gelöst wird, nicht die eigene Agenda, die auf Hochglanz getrimmt wird. „Leistung aus der zweiten Reihe“ nennt das eine junge Personalberaterin aus dem Milieu des Frankfurter Investmentbankings. „Assistenz ist Dienstleistung“, sagt sie. Sentimentales Rumgerede habe gar keinen Sinn. Die Assistentin sei im globalen Wettbewerb angekommen. Entsprechend „flexibel“ und „durchsetzungsstark“ habe sie zu sein. Und, ganz ungeschminkt: „Aussehen ist wichtig.“
Gute Assistentinnen zu finden ist allerdings nicht leicht. Heute hat erst die mittlere bis höhere Management-Ebene Anspruch auf persönliche Assistenz. Die Suche wird oft outgesourct, die meisten Firmen haben fast keine Personalabteilungen mehr, Anzeigen sind teuer. „Die heißesten Profile“, sagt eine Personalberaterin, die sich ihren Wunsch nach Anonymität schriftlich bestätigen lässt, „liegen in der Altersspanne zwischen 25 und 35.“ In diesen Jahren sei die Durchhaltefähigkeit und die Chance auf eine Karriere am größten. Die meisten Bewerbungen „scheiden sowieso aus“, sagt die Personalberaterin angestrengt höflich, höchstens drei bis fünf Prozent der Kandidatinnen seien fähig, „ein Anfangsinteresse zu wecken.“ Diesen Frauen empfiehlt sie für die Karriereplanung: „Nicht zu lange bei einem Arbeitgeber bleiben!“ Andererseits auch nicht „zu unruhig“ zu werden im Lebenslauf! Jedenfalls nicht, sofern die Damen einmal Vorstands-Assistentinnen in einem der zehn ersten DAX-Unternehmen werden und ein Jahresgehalt zwischen 55000 und 80000 Euro plus Boni verdienen wollen.
Man stellt es gern als Frage des Prestiges dar. Als eine der Hierarchie. Je ranghöher der Chef, die Chefin, desto größer das eigene Renommee. Frank Lutz, Marketing-Leiter von Esselte Leitz und verantwortlich für die Suche nach der „Besten Sekretärin Deutschlands“, zeigt sich amüsiert über den Standesdünkel der Very Few. Maximal sind es 200 Frauen, die die Spitze des Berufsfelds verkörpern, das ominöse „Vorzimmer der Macht“. Nicht selbstbewusst, nein, „wahnsinnig selbstbewusst“ seien diese Damen, weiß Lutz. Man kenne sich, tausche sich aus im kleinen Zirkel. „Und wenn Bundeskanzlerin Merkel und Daimler-Chef Zetsche sich treffen wollen“, sagt Lutz, „funktioniert das auch deshalb so schnell, weil die beiden Sekretärinnen sich kennen.“ Diesen Damen, sagt er, käme es selbstverständlich niemals in den Sinn, sich unters Volk zu mischen oder gar Interviews zu geben. Von Merkels Büroleiterin Beate Baumann weiß man höchstens, dass sie Golf fährt und es hasst, fotografiert zu werden. An einem Wettbewerb teilnehmen? Sich um den Titel der besten Sekretärin Deutschlands bemühen? Unmöglich! Man hat es bereits geschafft, ist selbst auf „höchst subtile Weise“ mächtig. „Glauben Sie mir“, sagt Frank Lutz, „die haben Einblick in Sachen, die Sie und ich nicht einmal wissen möchten.“
Dies wäre der Blick durch’s Schlüsselloch, der Blick hinter die Fassade. Doch was erwartet man zu sehen? Medikamentenpackungen, Cognacflaschen? Die Wahrheit darüber, was jemand tatsächlich denkt? Vielleicht könnte man auf ein paar Details des inner circle hoffen, sich der alten Klischees bedienen: Sie ist die Frau an seiner (oder ihrer) Seite. Die schärfste Rivalin all derer, die sich zu Unrecht in ihre (oder seine) Nähe wagen. Sie ist die Vertraute, die Mitwisserin, das Orakel. Sie kann jemanden warten lassen, kann so oder so „Guten Morgen“ sagen. Helmut Kohls Sekretärin Juliane Weber muss eine Meisterin dieser Art von Demütigung gewesen sein. Die Psychologie spricht hier von „Rollenstress“. Von gesteigertem job involvement, dem die Frauen unterliegen. Sie identifizieren sich, übernehmen die Perspektiven der Macht, ohne an dieser wirklich teilzuhaben. Sie sei keine Politikerin, sagt Beate Baumann. Das stimmt – und stimmt auch nicht.
Dabei steht am Anfang ihres beruflichen Weges historisch eine Degradierung. Die Männer, jahrhundertelang privilegiert für den Beruf des Schreibers und Sekretärs, waren sich für das Büro nämlich auf einmal zu fein. Das lag an der Schreibmaschine. Am Schreiben selbst, das mechanisch wurde. Das nichts mehr zu tun hatte mit einer persönlichen Handschrift. Über Epochen hinweg hatte ein Sekretär vor allem schön zu schreiben. Schmuck und Siegel sollte der Schriftzug sein. Allmählich ging diese Liebe zum Ornamentalen zurück. Die Wirtschaftsleistung, die steigende Produktivität ließ die Verzierung der Schrift immer weniger zu, und schließlich forderte der Druck der Industrialisierung eine anonymere Schrift. Ersetzbar musste ihr Schreiber sein. Austauschbar je nach Verschleiß. Die entscheidende Erfindung hört am Ende auf den Namen Remington Number One, Anno 1874 kommt sie in Serie auf den amerikanischen Markt. Eine Unteranschlagmaschine mit Standardtastatur in Schwarz.
Und die Sekretärin wird gleich mitgeliefert. Als Vorführdame, als Animiermädchen, die den äußerst schleppend anlaufenden Verkauf beschleunigen, die Scheu vor dem uneleganten Kasten nehmen soll. Wenn eine junge Frau diese Maschine bedienen kann, wer sollte es dann nicht vermögen? Die Firma Remington richtet begleitend Schreibmaschinenschulen ein, eine Stellenvermittlung für Stenotypistinnen. Die Männer halten sauber Abstand. Das „Tippfräulein“ kann doch bitte schreiben, kann im ohrenbetäubenden Lärm der Schreibsäle, die weit abliegen von den ruhigeren Zimmern der Prokuristen, die Buchstaben dreschen. Man unterstellt eine angeborene weibliche Robustheit, und schult die „Maschinenfräuleins“ in kerzengerader Haltung.
Stunde um Stunde. Die Hände schweben absolut ruhig über der Tastatur, die Arme sind leicht abwärtsgeneigt. Die Augen blicken nach vorn. Fehler sollten keine passieren, wenn doch, fängt das „Schreibmädl“ eben wieder von vorne an, oder es versucht, mit der Rasierklinge die Tinte vom Papier zu kratzen. Wie oft nimmt sie Kopfschmerzen und „Nervensausen“ mit in den Feierabend!
Doch ein Beruf ist ein Beruf. Man verdient das erste eigene Geld, dazu ist die Büroarbeit sauber. Gottlob ist man nicht in der Fabrik. Zum Aufstiegsberuf wird die Sekretärin für junge Arbeiterinnen. Zuerst aber ist sie der Beruf für das Mädchen aus dem Mittelstand. Man gewinnt ein Stückchen Freiheit von der Familie, wohnt eventuell in einer eigenen kleinen Wohnung und trägt hübsche Kleider. Die Sekretärin avanciert zur erotischen Figur. Überall in den Romanen der Zwanziger- und Dreißigerjahre taucht sie auf. Als die unerfahrene Bewohnerin der Großstadt, die versucht, ihr Leben in die eigenen, zarten Hände zu nehmen und der vonseiten der Männer ständig die Übernahme droht. Sie sind hinter ihr her, versuchen sie rumzukriegen und in den Abgrund der Gosse zu stoßen. Irmgard Keun lässt 1931 in ihrem ersten Roman die Stenotypistin Gilgi sehr pragmatisch dazu raten. „Bloß keine Beleidigungstragödie à la Schicksale hinter Schreibmaschinen!“ Und ein bisschen Spaß darf man ja wohl haben.
Eine große Karriere ist ohnehin nicht in Sicht. Privatsekretärin könnte das Mädchen werden. Wenn sie Glück hat. Der Chef könnte sich in sie verlieben und es ernst meinen. Oder sie bleibt im Büro, wird älter, einsamer. Sie wird ihn an den Geburtstag seiner Nichte erinnern, an das Geschäftsessen kommenden Mittwoch, und er wird ihr sagen, wie unersetzlich sie ist. So will es wenigstens die Legende, die in ihrer prägenden Wirkung erstaunlich lange vorhält. Noch in den Achtzigern hat man sie gemaßregelt, ihr entweder ein trauriges Altjungferndasein oder gierige Absichten unterstellt.
Wie ein Schulmädchen hat man sie korrigiert. Streich’ Dir nicht durch die Haare! Halt’ Dich gerade! Ins Gesicht sollte sich die Sekretärin nicht fassen, schon gar nicht am Mund berühren. Beim Mittagessen in der Kantine soll sie sich nicht ausfragen lassen. Sie soll sich nicht befreunden mit den Kollegen, soll Abstand wahren. Das Lehrmaterial für Sekretärinnen vermittelt den peinlichen Eindruck eines Risikos. „Die Führungsgehilfin“ hat das Zeug dazu, ihren Chef womöglich bis auf die Knochen zu blamieren. Als die „umstrittenste Figur im Spiel unseres Wirtschaftslebens“, als „einen der häufigsten Scheidungsgründe“ hat man sie bezeichnet, als „Schwachstelle im vorbeugenden Geheimschutz“. Man könnte meinen, die Sekretärin sei Agentin im Kalten Krieg gewesen. Doch war der nicht lang vorbei?
37 Jahre alt ist sie heute. Verheiratet, keine Kinder. Ihr Vertrag führt sie als „Management-Assistentin“. „Die chicen neuen Namen“, glaubt die schlanke Frau, die mir in einer Eisdiele gegenübersitzt, „helfen nicht weiter.“ Alle Veränderungen habe die Technik besorgt, die digitale Revolution. Für den Berufsstand war das zunächst heikel. Was würde aus der Sekretärin werden, wenn der Computer die Arbeit viel schneller erledigt als sie? Schon galt sie als verloren. Jeder schreibt, plant und kämpft für sich allein. Mit der Internetblase ist auch diese Illusion zerplatzt.
Inhaltlicher sei die Arbeit geworden, sagt die Assistentin, entscheidungsfreudiger. Gut denken müsse man können. Ihr Diktiergerät steht im Schrank, sie benutzt es nur selten: „Wir sind keine Schreibkräfte mehr.“ Wie es weitergeht? Achselzucken, sie kann es nicht sagen. Die Anforderungen werden weiter steigen. Das Abitur wird mittlerweile vorausgesetzt, die Beherrschung zweier Fremdsprachen. Auch ein Studium schade nicht. Am besten, man verfügt über internationale Erfahrung und lernt in seiner Freizeit noch Chinesisch. Sie fänden keine guten Assistentinnen mehr, klagen viele Chefs. „Fragen Sie sie doch“, rät die Assistentin, die ein Headhunter unlängst abwerben wollte, „warum sie immer weniger zahlen.“
Sie selbst hat es noch auf die alte Weise geschafft. Wurde als Anwalts- und Notarsgehilfin ausgebildet, in einer Praxis à la Liebling Kreuzberg. Heute pflegt sie den Internetauftritt der Firma, spricht mit Kunden, betreut Layouts. Die Männer der mittleren Ebene, sagt sie, die Sachbearbeiter, „unterschätzen uns immer noch, die wollen den Chef sprechen.“ In ihrem Fall die Chefin, was die Sache nicht besser macht. Bisweilen rutsche ihre Chefin ins Divenhafte ab, erzählt sie. „Sie ruft an, erklärt, sie sei in zwei Stunden da und werde dann Hunger haben. Man solle etwas besorgen.“ Dabei läuft sie auf dem Weg ins Büro direkt an einer Gourmetzeile vorbei. Die Assistentin lacht über das Beispiel. Und über die Anrede „meine Mädels“, die ihre Chefin, die jünger ist als sie, ihr und einer zweiten Assistentin durch die offene Bürotür gerne hinüberruft.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false