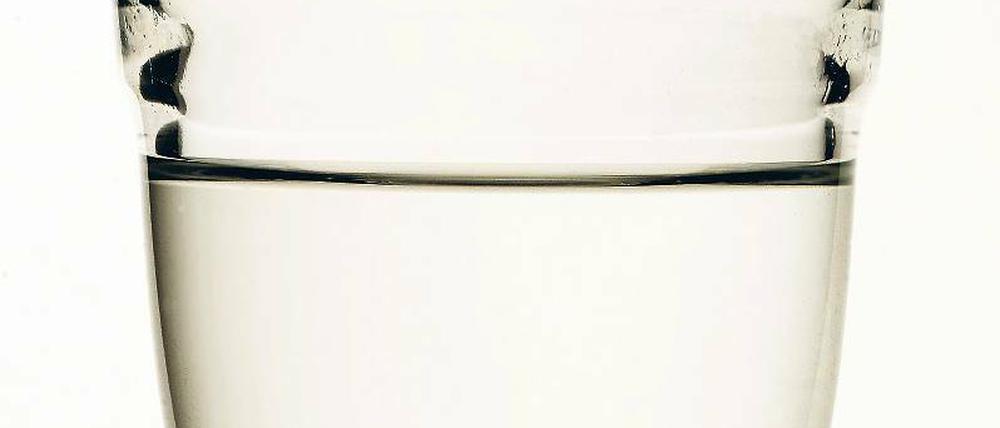
© Mike Wolff HF
Wirtschaft: Halbvoll? Halbleer?
Weiterbildung ist wichtig. Das weiß auch die Bundesregierung. Deshalb will sie den Bereich stärken. Ist das gelungen? Eine Bilanz.
Stand:
Egal ob Rhetorik-Seminar, Business-Englisch-Kurs oder berufsbegleitendes Studium: Ohne sich regelmäßig weiterzubilden, hat man auf dem Arbeitsmarkt schlechte Karten. Viele Arbeitnehmer nutzen daher die Möglichkeiten, die Volkshochschulen und private Institute bieten, um Wissen und ihre Fähigkeiten auf den neusten Stand zu bringen. Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) nahmen 2012 etwa 42 Prozent der Arbeitnehmer an beruflichen Weiterbildungen teil. Diese Zahl war in den letzten Jahren relativ stabil. Am häufigsten besuchten die Deutschen Kurzveranstaltungen wie Vorträge, Schulungen, Seminare oder Workshops. Sie machen 39 Prozent der betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten aus. 31 Prozent entfallen auf mehrtägige Kurse oder Lehrgänge. Schulungen am Arbeitsplatz wie Unterweisungen durch Vorgesetzte oder Kollegen, durch Trainer oder Lernprogramme liegen bei 29 Prozent.
Über die Relevanz des lebenslangen Lernens für den Einzelnen, die Gesellschaft und die Wirtschaft sind sich Politik, Gewerkschaften und Verbände einig. Laut dem BMBF sichere es die soziale Teilhabe, erhalte die Beschäftigungsfähigkeit der erwerbsfähigen Bevölkerung und verbessere die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der gesamten Wirtschaft.
Aber wo stehen wir wirklich? Im europäischen Vergleich liegt die Weiterbildungsquote laut dem Bildungsministerium mit 31 Prozent zwar höher als in den meisten anderen europäischen Ländern. Stephanie Odenwald stellt der Weiterbildung in Deutschland trotzdem kein gutes Zeugnis aus – höchstens ein befriedigendes. Als Mitglied eines gewerkschaftlichen Beratungsgremiums der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) arbeitet sie an einer Pisa-Studie über Erwachsenenbildung mit. Die Ergebnisse werden im Herbst 2013 vorgestellt. „Aus den dort erhobenen Zahlen und Fakten geht hervor, dass Deutschland in Europa in Sachen beruflicher Weiterbildung bei Weitem nicht Spitzenreiter, sondern eher im unteren Mittelfeld angesiedelt ist“, sagt sie. Lernen könne man von den skandinavischen Staaten, wo das Angebot stärker ausgebaut und besser organisiert sei.
Weiterbildungsexperte Knut Diekmann vom Deutschen Industrie- und Handelkammertag (DIHK) sagt: „Die Ausbildung ist so etwas wie die ‚Eintrittskarte’ auf den Arbeitsmarkt. Weiterbildung erhöht die Karrierechancen.“ Dabei zeige sich, dass die Verdienstchancen mit der Höhe der Bildungsabschlüsse steigen. Un- und Angelernte trügen das größte Risiko einer Arbeitslosigkeit. „Gleichzeitig gilt aber auch: Immer weniger Menschen arbeiten ein Leben lang in ihrem angestammten Beruf. Daher müssen wir beruflich mobil bleiben.“
In die berufliche Weiterbildung investierten Unternehmen etwa 8,6 Milliarden Euro pro Jahr (Stand 2010). Laut einer Umfrage des DIHK aus dem Jahr 2011 möchten 38 Prozent der befragten Betriebe ihre Schulungen in den nächsten Jahren ausbauen. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Viele Firmen wollen durch Weiterbildung der Belegschaft einem drohenden Fachkräftemangel vorbeugen und wettbewerbsfähig bleiben.
Laut Stephanie Odenwald, die auch den Vorstandsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) leitet, kämen durch die Globalisierung neue Herausforderungen auf die Arbeitnehmer hinzu. Fremdsprachen zu sprechen sei in vielen Berufen unabdingbar. „Diese Nachfrage schlägt sich im Angebot der Volkshochschulen nieder. Sprachkurse haben in den letzten Jahren stark zugenommen, dafür ist das Angebot an Kursen zur politischen Bildung zurückgegangen“, sagt sie.
Gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der IG Metall engagiert sich die GEW in der „Initiative Bundesregelungen für die Weiterbildung“. Das Bündnis fordert ein Bundesgesetz, dass die Weiterbildungschancen und Bedingungen verbessern soll. Laut Mechthild Bayer, Bereichsleiterin für Aus- und Weiterbildung bei Verdi, soll es ein „Recht auf Weiterbildung, Lernzeitansprüche, ausreichende Finanzierung, Beratung und Qualität sichern und für alle mehr Verlässlichkeit herstellen“. Für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Forum Wissenschaft“ des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat sie den Beitrag „Notstand – Berufliche Weiterbildung in Deutschland“ verfasst. Sie schreibt: „Gravierende und durchaus bekannte Defizite hinsichtlich Zeit, Finanzierung, Information und Transparenz, Qualität und Verwertung verhindern, dass lebenslanges Lernen zum selbstverständlichen und kalkulierbaren Teil von Biographien werden kann.“
Als Beleg dient ihr der Bildungsbericht 2012, der von einer Gruppe unabhängiger Wissenschaftler im Auftrag der Bundesregierung erstellt wird. Darin heißt es, dass Weiterbildungen besonders von höher qualifizierten Arbeitnehmern in Anspruch genommen werden. Die Menschen, die sie eigentlich dringender benötigen – Arbeitslose und Ältere – machen einen vergleichsweise geringen Prozentsatz aus.
Was also hindert Menschen daran, an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen? Laut Stephanie Odenwald ist es nicht nur der finanzielle Aspekt, denn staatliche Förder-Programme wie die Bildungsprämie bezuschussen berufliche Weiterbildungen. „Viele Menschen mit einer geringen Bildung haben in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht und Angst davor, sich in einem solchen Kurs zu blamieren“, sagt sie. Um den Zugang zu beruflicher Weiterbildung zu erleichtern, hält Stephanie Odenwald kommunale Beratungsstellen für unverzichtbar.
Vorbildlich sei in dieser Hinsicht die Bildungsberatung Berlin unter der Leitung des freien Trägers Arbeit und Leben e.V. Auf der Internetseite www.bildungsberatung-berlin.de und in Beratungsgesprächen bekommen interessierte Bürger Informationen zu passenden Angeboten und Finanzierungsmöglichkeiten.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: