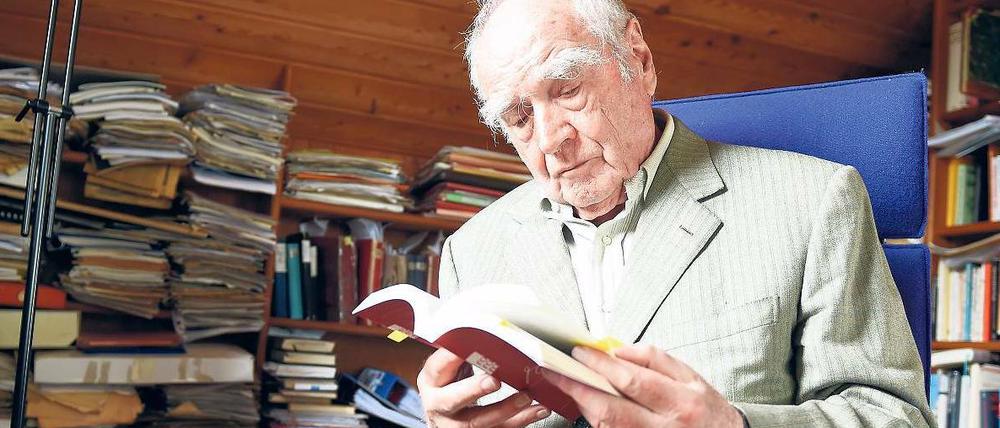
© Felix Kästle/dpa-pa
Begegnung mit Martin Walser: Ein schreibender Mann
Die Sprache, die Geschichte, die deutsche Schuld: eine Begegnung mit Martin Walser. Ihn beschäftigt die Literatur, nicht mehr der Diskurs. Und doch sucht er die Öffentlichkeit.
Er macht einen aufgeräumten, vitalen Eindruck an diesem Morgen in der Eingangshalle des Hôtel de Rome in Berlin. „Kommen Sie“, ruft er, „ich habe uns ein schönes Eckchen reservieren lassen“, und schon schreitet der 88-Jährige zügigen Schrittes voran. Nach einer Grippe mit sich anschließender Lungenentzündung und mehreren Krankenhausaufenthalten scheint Martin Walser wieder voller Tatendrang zu sein und keine Termine und Lesungen zu scheuen, um immer wieder Neues aus seiner nie nachlassenden Produktion vorzustellen. Demnächst beim 4. Potsdamer Literaturfestival ab dem 3. Juli.
Zum einen gibt es da den vierten Band seiner Tagebücher, dieses Mal aus den Jahren 1979 bis 1981. Und zum anderen die 2014 und 2015 veröffentlichten Bücher, die sich mit der deutschen Schuld auseinandersetzen: die Anthologie „Unser Auschwitz“, die ältere Essays, Theaterstücke, Romanauszüge und die Paulskirchenrede enthält, sowie das „Denkmal“, so der Untertitel, die mitunter hymnische Abhandlung über den jiddischen Dichter Sholem Abramovitsh, „Shmekendike Blumen“. Letztere beiden laden natürlich zu vielfältigen Interpretationen ein. Zumal Walser im Zusammenhang mit der Abramovitsh-Veröffentlichung bekannte, dass er nach der Lektüre der Bücher des jiddischen Dichters die Paulskirchenrede von 1998 so wie damals nicht mehr halten könnte.
Walser sagt das an diesem Morgen wieder, fast wie ein Mantra, auf die Frage, ob er sich heute nicht ärgere, Abramovitsh nicht schon viel früher gelesen zu haben: „Alles hatte seine Notwendigkeit. Wenn ich ihn damals schon gelesen hätte, hätte ich die Paulskirchenrede so nicht halten können, weil mir die Fülle des jüdischen Lebens erst durch Abramowitsh aufgegangen ist.“ Er sagt: „Wir bleiben die Schuldner gegenüber den Juden, da gibt es keine Bewältigung, keine Verharmlosung, kein Ausweichen.“ Und er sagt: „Ich würde niemals eine Meinung über Israels Politik so oder so wagen. Es ist vollkommen egal, was Israel macht – wir müssen dafür sein, weil wir schuld daran sind, dass es so gekommen ist. Ja, es gibt rührende, ernst gemeinte Meinungsdifferenzen zu Israel, was ich absurd finde: Durch Abramovitsh hat sich das für mich erledigt!“
Literatur hilft, Völker und Länder zu verstehen
Man spürt, dass es Walser ein Anliegen ist, gerade über diesen „so gewaltigen Autor zwischen Kafka und Swift“ zu reden und mit welcher „unvorhersehbarer“ Wucht ihn die Lektüre von dessen Büchern getroffen hat. Das aber immer, das betont er, vor dem Hintergrund, dass die Literatur für ihn „die höchstmögliche Auskunft“ sei, er durch die Literatur Völker und Länder sehen und verstehen lerne: „Dostojewski ist für mich Russland, nicht der Stalinismus, Faulkner ist für mich die USA, nicht Watergate, der Irakkrieg oder sonstwas.“
Und durch Sholem Abramovitsh, der 1917 in Odessa im Alter von 82 Jahren starb, ist Walser das jüdische Volk „jetzt, erst jetzt wirklich bekannt geworden“, wie er das in dem Buch über den jiddischen Dichter schreibt: „Ich erlebe ein Nicht-mehr-infrage-Kommen für das sogenannte Hier und Heute. Eine vollkommene Eingenommenheit. Von ihm. Ich kann nichts dagegen tun, in mir dominiert die Mitteilung, dass wir dieses Volk umbringen wollten und zu Millionen umgebracht haben.“
Man spürt aber im Gespräch genauso, dass Walser wieder im Clinch liegt mit Teilen der Kritik, er das „rührende Unverständnis Ihrer Branche, das ich erleben durfte“ gar nicht so rührend findet, sondern ihn das ärgert, die mitunter negative Resonanz auf das Abramovitsh-Buch. Antisemitismus wurde ihm wieder vorgeworfen, weil er behauptet hatte, Juden träumten anders: „Was für ein Ignoranzvolumen dieser Punkt signalisiert: Eines ihren Menschrechts beraubtes Volk! Natürlich haben Juden anders geträumt!“
Auschwitz ist kein Diskursgegenstand
Auch dass es nun heißt, er sei auf Rehabilitationskurs, er sei bekehrt worden, will Walser nicht stehen lassen: „Ich hätte nur anders empfunden. Aber ich hätte keine andere Tendenz entdecken können in diesem furchtbaren Geschehen. Auschwitz war für mich kein Diskursgegenstand und ist es heute nicht. Es kann kein Meinungshinundher darüber geben, für meine Generation ist das garantiert so. Das ist absolut, bedingungslos.“
Es ist ein nach wie vor schwer zu begehendes und vermintes Terrain, auf dem Walser sich bewegt. Missverständnisse gehören da weiterhin, wenn man so will, zum Diskursprogramm, gerade in seinem Fall. So sollte dann auch die von Rowohlt-Verleger Alexander Fest initiierte Veröffentlichung des „Unser-Auschwitz“-Walser-Sammelbandes der Verklarung dienen. Als Reaktion auf die Walser-auf-Rehabilitationskurs-Interpretationen nach dem Abramovitsh-Buch, „als Dienstleistung einem Gewerbe gegenüber, dem es an Informationsfleiß gelegentlich fehlt“, wie es Walser im Hôtel de Rome etwas hämisch ausdrückt.
Tatsächlich braucht man nur seine beiden überragenden, heute genau wie damals geltenden Auschwitz-Essays zu lesen („Unser Auschwitz“ von 1965, „Auschwitz und kein Ende“ von 1979) oder auch die über Heine, Kafka, Klemperer oder Borchardt, um zu erkennen, dass Walser kein Antisemit, kein Deutsche-Schuld-Verharmloser, Verdränger oder Schlussstrichzieher ist, dass er das auch nie gewesen ist.
Nur geht es ihm immer heute mehr denn je primär um die Literatur, geht er direkt in die Sprache hinein. Auch jetzt, da er in einem behaglichen Hotel-Separee sitzt, zeigt er sich erneut überwältigt von Kafka und wie der so genau gehört habe, „was das Jiddische für eine gewaltige Sprache“ ist. Und natürlich von Abramovitsh, der Russisch und Hebräisch sprechen und schreiben konnte, aber das Jiddische, diesen im Mittelalter ausgebildeten Dialekt, zu seiner Literatursprache gemacht hat.
Es ist gar nicht so einfach, um nicht zu sagen: unmöglich, Walser von sich, seinen Empfindungen, von der Literatur wegzubewegen. Ob zum Beispiel seiner Forderung von damals, aus der Paulskirchenrede, andere Sprechweisen zu finden, andere Formen des Erinnerns zu entwickeln, nachgekommen worden sei? Oder die Frage nach der ritualisierten Erinnerungskultur: Stellt die sich nicht nach wie vor, stärker noch als vor fast zwanzig Jahren?
Gegen die Wahrheit der Sprache gibt es kein Mittel
Walser blockt bei solchen Fragen konsequent ab. Er schaut einen ganz milde aus seinen nach wie vor von enorm dichten, weißen Brauen überwölbten Augen an und winkt ab: „Das interessiert mich heute nicht mehr, das ist Diskurs.“ Und er verweist auf sein 2011 veröffentlichtes Buch „Über Rechtfertigung“, in dem er seinen Ausstieg aus dem „Reizklima des Rechthabenmüssens“ verkündete.
Einen Ausstieg, den er übrigens, so sagt er, vor viel längerer Zeit schon vorgenommen habe, 1979, mit seinem Essay „Händedruck mit Gespenstern“ für den von Jürgen Habermas herausgegebenen Edition-Suhrkamp-Band „Zur geistigen Situation der Zeit“. Darin hatte Martin Walser postuliert, dass ihm nicht Meinungen als solche, aber das Meinen fremd geworden sei. Dass die Vielfalt von Meinungen Meinungsvielfalt nur vortäusche, solange in den jeweiligen Debattenbeiträgen nicht alle Widersprüchlichkeiten vorkommen und aufgedeckt würden. Später hat er das auf die Formel „Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr“ gebracht. Heute erinnert er sich: „Ich habe damals versucht, meinen Text- und Schreiberfahrungen gerecht zu werden. Öffentliches Schreiben und Reden und Meinen lässt immer die Widersprüche außen vor, und das macht unsere ganze Meinungskultur zu einem öffentlichen Kunstgebilde.“ Und er weiß noch: „Als die Veröffentlichung des Bandes gefeiert wurde, war das erste, was Habermas zu mir sagte: Du hast einen furchtbaren Aufsatz geschrieben.“
Walser ist sich natürlich über einen Widerspruch im Klaren. Einerseits hält er es mit dem Klemperer-Zitat, dass es gegen die Wahrheit der Sprache keine Mittel gebe, dass Genauigkeit die oberste Tugend sein müsse. Er stellt sich andererseits aber durchaus stets aufs Neue der Öffentlichkeit, stellt sich in diese hinein, nur um konstatieren zu müssen, dass es hier nicht um Genauigkeit und Sprachwahrhaftigkeit geht, sondern klare Kanten und Oberflächen gefragt sind.
In seinem neuen Roman gebe es einen Lyriker, so Walser, der glaubt, dass Sprache unverständlich beziehungsweise jedem beliebigen Verständnis ausgesetzt sei. „So ist es. Davon leben wir“, sagt er. Und schließt daran an, fast ein wenig triumphierend: „Falls Sie wissen wollen, wie der Roman heißen wird: ,Ein sterbender Mann’“. Was dem Titel nach mit seinem Goethe-Roman „Ein liebender Mann“ korrespondiert.
Dann schaut er einen an, gar nicht grimmig, sondern fröhlich und höchst lebendig, und verabschiedet sich.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false