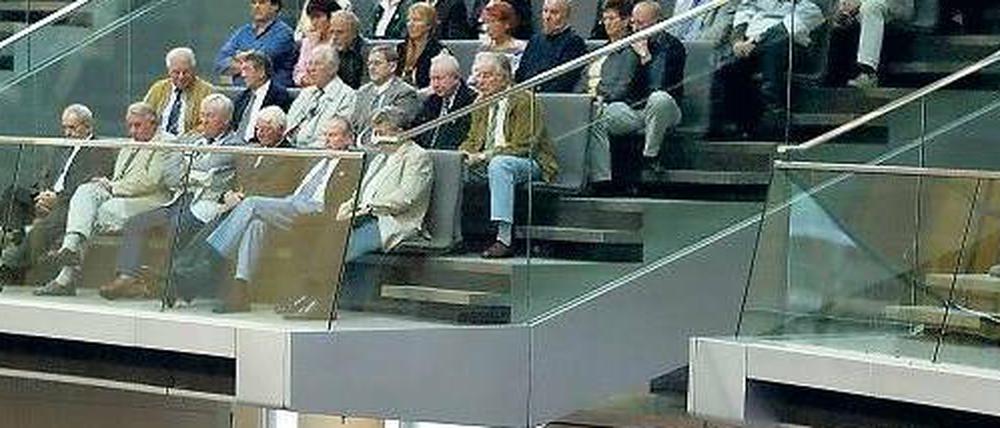
© picture-alliance / dpa/dpaweb
Politische Systeme: Warum die repräsentative Demokratie nicht jedem gefällt
Atomkraft, Hartz IV, Stuttgart 21: Bürokraten, Cliquen, Politkasten - wer entscheidet eigentlich in Deutschland?
Stand:
Man muss sich, um die Stimmungslage vieler Leute zu verstehen, in Erinnerung rufen, was in den letzten Jahren passiert ist. Eine neue Regierung wurde gewählt. Diese Regierung tut, in weiten Teilen, ungefähr das Gegenteil dessen, was sie versprochen hat. Das Programm der FDP kann man an die Hasen verfüttern. Vereinfachung des Steuersystems? Steuersenkungen? Einfaches Gesundheitssystem? Vergesst es! Völlig unrealistisch!
Vor den Wahlen war es realistisch. Nach den Wahlen ist es unrealistisch. Lektion eins: Sie lügen, um leichtgläubigen Menschen ihre Stimmen abzuluchsen.
Zum zweiten Mal in Folge wurde das höchste Amt des Staates in einer Nachtund-Nebel-Aktion vergeben, eine Hausbesetzeraktion. Die Sympathien der Bevölkerung spielten so wenig eine Rolle wie die Eignung der Kandidaten. Entscheidend war das Machtinteresse der Parteien, besser gesagt, der Kanzlerin. Würde des Amtes? Tut die Würde des Bundespräsidenten-Amtes in den Hasenstall, dorthin, wo schon das FDP-Programm liegt. Lektion zwei ist eine Songzeile von Michael Jackson: They don’t really care about us.
Der relativ zügige Ausstieg aus der Kernenergie wurde von der Regierung widerrufen, obwohl es im Falle von Stuttgart 21 heißt, das Volk habe einmal beschlossene demokratische Entscheidungen gefälligst zu respektieren. Sonst werde das Land unregierbar. Die SPD dagegen, die Hartz IV auf den Weg gebracht hat, setzt sich sogar von den Ergebnissen ihrer eigenen Regierungskunst ab. Sobald sie in der Opposition sitzt, ist sie sofort gegen sich selber. Von den Parteien darf offenbar jederzeit alles widerrufen werden.
Es wird viel demonstriert neuerdings, und es wird viel über eine Legitimationskrise der Parteiendemokratie geschrieben. Politologen beschreiben allerdings schon seit Jahren den Bedeutungsverlust des Parlaments, in dem es nur noch selten wirklich um etwas geht. Die politischen Entscheidungen fallen anderswo, im Zweifelsfall im Büro der Kanzlerin. Bei vielen hat sich der Eindruck festgesetzt, von einer unkontrollierbaren Bürokratie regiert zu werden, von undurchschaubaren Cliquen, einer Politkaste, die ihre Beschlüsse von einflusslosen Parlamentarier-Marionetten abnicken lässt.
Nun ist das alles nicht neu. Intrigen, Täuschungen und Absprachen im Hinterzimmer gehören seit jeher zur Politik, anders kann vermutlich überhaupt nicht regiert werden. Wer daran zweifelt, muss nur Politiker-Biografien lesen, von Adenauer, Brandt oder Bismarck. Diese Dinge hat das Volk gelassener hingenommen, als Ideologien noch eine große Rolle gespielt haben. Was tut man nicht alles, um, je nachdem, die Roten oder die Schwarzen zu verhindern! Da heiligt der Zweck eben manchmal die Mittel. Je näher die Parteien aneinanderrücken, desto leichter wiegt dieses Argument. Die Wähler, die heute bei dieser Partei ihr Kreuz machen und morgen bei einer anderen, verhalten sich wie selbstbewusste Kunden. Sie verlangen ein gutes Produkt und sie lassen sich nicht gerne übers Ohr hauen.
Eine beliebte Methode des Übersohrhauens besteht darin, Entscheidungen als alternativlos darzustellen – es muss so sein, es geht gar nicht anders. Wenn das wahr wäre, bräuchte man im Grunde keine Wahlen. Man könnte, nein, man müsste das Regieren den Experten überlassen. Tatsächlich aber gibt es fast immer mehrere Möglichkeiten. Wenn man etwas für die Verkehrsinfrastruktur tun möchte, kann man einen neuen Bahnhof bauen, man kann aber auch, nur ein Beispiel, das verrottete Schienensystem großflächig modernisieren. Auf vielen Strecken in Deutschland fahren die Züge heute langsamer als vor 20, 30 Jahren. Es ist eine Entscheidung.
Und Stuttgart 21 ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Cliquendemokratie funktioniert, ein System, in dem eine kleine Kaste von Entscheidern die Weichen stellt, die Parlamente nur Staffage sind und das Volk vor allem als Störfaktor wahrgenommen wird. Alle wichtigen, bindenden Verträge wurden, wie die „Süddeutsche Zeitung“ in einer Dokumentation darlegt, für die sie hoffentlich einen Preis bekommt, 1994/95 im kleinen Kreis von Managern und Führungspolitikern ausgeheckt und in den damals weitgehend ahnungslosen Parlamenten – Fraktionsdisziplin! Tolles Projekt! Eilig, eilig! – durchgewunken, ohne Prüfung von Alternativen, ohne Machbarkeitsstudien.
In München und Frankfurt lehnte man, zwei Jahre später und nach etwas genauerem Hinsehen, ähnliche Pläne ab. In Stuttgart sah es fast wie ein Putsch aus. Alles ging blitzschnell, es gab eine Pressekonferenz und kurz danach Gemeinderatswahlen, bei denen kaum ein Wähler über die Bedeutung des Projektes Bescheid wusste – schon war die Sache legitimiert. Und es ging darum, die Stadt komplett umzukrempeln. Im anschließenden Planfeststellungsverfahren durften die Bürger dann nur noch Detailkorrekturen vorschlagen, schon damals berief man sich auf bindende Verträge, wie seitdem ununterbrochen. Seit 15 Jahren beruft man sich auf diese Verträge. Sie waren fertig, bevor auch nur annäherungsweise so etwas wie ein demokratischer Meinungsbildungsprozess hätte stattfinden können. Die Berufung auf Verträge kommt bei den gutbürgerlichen Demonstranten und Häuslebauern nicht gut an. Da gibt es kaum einen, der nicht schon mal aus einem Vertrag wieder herausgekommen wäre, vor allem, wenn der Handwerker plötzlich seine Preise verdoppelt.
Deshalb, unter anderem, die Krise der Parteiendemokratie: Es genügt nicht, komplizierte, aber folgenschwere Sachfragen, die jeden betreffen, den Parlamenten vorzulegen. Sie sind oft überfordert, und sie stehen unter Druck. Nicht unter dem Druck der Straße, der legitim ist, schließlich gibt es das Recht auf Demonstration, überhaupt gehört die Formulierung „Druck der Straße“ eher zum Wortschatz einer absoluten Monarchie. Parlamentarier stehen unter dem Druck von Regierungs- und Fraktionsspitzen, die längst alle Beschlüsse gefasst haben. Die Parlamente entscheiden – dieser Satz ist zu einfach, er beschreibt nicht, wie Entscheidungen tatsächlich zustande kommen.
Die öffentliche Schlichtung, aktuell in Stuttgart, leidet unter dem Grundwiderspruch, dass es zwischen den Lösungen „bauen“ und „nicht bauen“ keinen Kompromiss geben kann. Ein bisschen bauen? An Volksabstimmungen führt bei solchen Projekten kein Weg vorbei. Es sei denn, man gibt den Gedanken auf, dass bei uns der Souverän das Volk ist. In Deutschland sind keineswegs, wie Guido Westerwelle behauptet, Großprojekte unmöglich geworden. Vielleicht ist es unmöglich geworden, Großprojekte in Nacht- und Nebelaktionen durchzusetzen, ohne Debatte, gegen den Willen einer Mehrheit. Aber das wäre gut.
Der Primat der repräsentativen Demokratie und die Skepsis gegen Volksabstimmungen speisen sich aus einem Grundverdacht: Ist dem Volk, zumal in Deutschland, zu trauen? Kriegen wir die Todesstrafe? Werden Anti-Migranten-Gesetze kommen, Thilo-Sarrazin-Gesetze? Populismus gibt es allerdings auch ohne Volksabstimmungen, gerade im Fall von Sarrazin kann man das sehr schön beobachten. Der Mann ist angeblich skandalös, aber das hindert seine Ideen keineswegs daran, recht flott Eingang in die politische Rhetorik von Angela Merkel und Horst Seehofer zu finden.
Aber es stimmt ja: Das Volk ist in seinem Verhalten schwer auszurechnen. Es wird nicht immer so entscheiden, wie man selber es gerne hätte. Wenn tatsächlich alle Staatsgewalt von diesen schwer einschätzbaren, aber im Grunde nicht ganz dummen Leuten ausgeht, dann müssen sie sich auch irren dürfen. Aber es wird dann Entscheidungen geben, die von allen akzeptiert werden.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: