Detektiv Spenser hat es dieses Mal mit dem „Fleischhandel“ in New York und Boston zu tun.
Literatur
Kerstin und Gunnar Decker: Über die unentwickelte Kunst, ungeteilt zu leben. Eine Deutschstunde.
Andrew J. Bacevich weist den USA den Weg in ein neues „amerikanisches Jahrhundert“.
Die Abwanderung aus der DDR in die BRD und nach West-Berlin als innerdeutsches Migranten-Netzwerk. Ch. Links, Berlin 2009. 650 S., 49, 90 €.
Zwei Bücher über Schabowskis Irrtum und Schabowskis Rechtfertigungen.
Drei Poptheoretiker und ein Wissenschaftler widmen sich der Bundesrepublik.
Neu aufgelegt: Raymond Queneaus früher Roman „Odile“ aus dem Jahr 1937 spielt mit Liebe und Zufall und verarbeitet parodistisch Queneaus Zeit in der surrealistischen Bewegung, der er von 1924 bis 1929 angehörte.
Eva Menasse erzählt von Menschen mit leichten Verfehlungen. Zwar sind nicht alle Geschichten gleich gelungen, aber alle mit leichter Hand geschrieben, bissig und spitz, wenn es um „eine stadtschlank gehungerte Landmaid“ geht, pointiert und lakonisch auch da, wo Melancholien und Enttäuschungen verhandelt werden.
E s sind wieder bewegte Suhrkamp-Zeiten. Nicht nur, dass der Verlag von Frankfurt nach Berlin umgezogen ist, er feiert in diesem Jahr auch sein 60-jähriges Bestehen. Gerrit Bartels über das Jubiläumsprogramm des Suhrkamp Verlages.
Die Ordnung im Chaos: Umberto Eco schreibt eine Kulturgeschichte des Listenwesens und versucht den Balanceakt zwischen didaktischem Eifer und essayistischem Ehrgeiz.
Nicht nur Bilder sonder vor allem wissenschaftlich fundierte Texte prägen das neue Buch von Katrin Klitzke und Christian Schmidt über Streetart. Das funktioniert - aber nicht für jeden.
Ein Buch klärt über Künstlerrechte auf: Der Zugang zum Künstlerberuf ist frei und voraussetzungslos. „Diese Freiheit ist leider in der Realität oft auch eine Vogelfreiheit“, schreibt Gerhard Pfennig in der Einleitung zu seinem Buch „Kunst, Markt und Recht“.

Joachim Sartorius und Judith Schalansky beschäftigen sich mit einer zwiespältigen Sehnsucht.

Wie hältst du’s mit der Religion: Charles Taylor erzählt die Geschichte der Säkularisierung.
Von der Illusion des Vertragens zur Reife des Ertragens: Arnold Retzer erklärt, wie Ehen dauerhaft funktionieren.
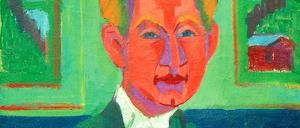
Museumsmann, Politiker und Mitbegründer des Tagesspiegels – eine neue Biografie würdigt Edwin Redslob.
Informativ, aber nicht immer konzise: Richard J. Evans schließt sein Standardwerk zur NS-Zeit ab.

Menschenfreund und Menschheitsskeptiker: 50 Jahre nach dem Tod von Albert Camus ist sein Werk aktueller denn je.
Die Historikerin Susanne Heim veröffentlicht Dokumente zur Judenverfolgung.
Matthias Küntzel über Deutschlands verhängnisvolle Beziehung zum Iran.
Thomas von Steinaeckers lustvolle Inszenierung deutscher Klischees
In letzter Zeit habe ich manchmal den Eindruck, mit meiner kleinen Hörbuchecke ganz am Ende einer langen, geschäftig rasselnden Verwertungskette zu sitzen, und ich frage mich: Was kommt hier hinten bei mir eigentlich an? Dass nach wie vor Produktionen, die es exklusiv nur in Hörbuchform gibt, eine absolute Ausnahme darstellen, wurde an dieser Stelle schon oft genug bemängelt – und ebenso, dass weder eine Fernseh-, noch eine glitzernde Kino-Karriere der Akteure zwangsläufig fürs Hörbuch prädestiniert.
Vom Nutzen und Nachteil der Erinnerung: Dorothea Dieckmanns Roman „Termini“
Wie historische Symbole sich wandelnden Deutungen unterliegen: Eine Anthologie über die Erinnerungsorte der DDR
Harry Potter vor Harry Potter vor Dan Brown ... Ansonsten ist nichts passiert bei den Büchern in den Nullerjahren – was traurig ist, aber natürlich überhaupt nicht stimmt.
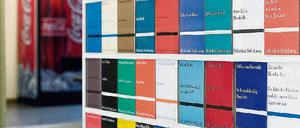
Frankfurter Melancholie: eine Liebeserklärung an den Suhrkamp Verlag
Verfolgung, Bespitzelung, Verhaftung: Dietrich von Maltzahn hat aufgeschrieben, wie ein Leben in der DDR verlaufen konnte
Von Hitler zu Adenauer: Jürgen Bevers widmet sich der Karriere des fähigen Beamten Hans Globke
Neu übersetzt: Leonard Cohens Debütroman „Das Lieblingsspiel“. Nicht jeder weiß, dass Leonard Cohen zwei Romane schrieb, bevor er als Sänger bekannt wurde. Sowohl „Beautiful Losers“ (1966) wie Cohens Erstling „The Favourite Game“ (1963) waren schon auf Deutsch erhältlich.

Wolfgang Sofsky kämpft sich durch einen Katalog der menschlichen Laster. Sofsky will sich nicht von konkreten Beispielen verführen lassen, man könnte auch sagen: Er mag sich keine Mühe mit ihnen machen.
Kolja Mensing über einen kleinen neapolitanischen Führer.
Uwe Wittstock sucht die Postmoderne in der deutschen Gegenwartsliteratur. Es ist eine Vielfalt von Formen, Themen, Traditionen und Experimenten, eine „radikale Pluralität“, die Wittstock konstatiert.
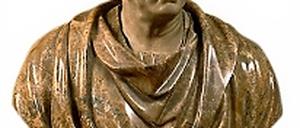
Robert Harris’ Cicero-Thriller „Titan“ ist ein Lehrstück über die Korrumpierbarkeit der Macht. Das Stück bezieht den Großteil seiner Spannung aus der Verkettung der Ereignisse sowie aus der Ahnung, dass Cicero als Emporkömmling, den weder Abstammung noch Geld an die einflussreichen Kreise in Rom binden, viel schwächer ist als seine Gegner.
Der Kulturpublizist Henning Rischbieter hat seine Memoiren geschrieben – ein deutsches Exempel.
Elizabeth und Stuart Ewen: Typen und Stereotype. Die Geschichte des Vorurteils, parthas Verlag, Berlin 2009, 582 S.

Vorbild Kroatien, Desaster Kosovo: Zwei Spiegel-Autoren über den Balkan als Interventionsort
Zwischen Anpassung und Aufruhr: Der Historiker Gerhard Sälter hat die Geschichte der DDR-Grenzsoldaten geschrieben.
Es ist Frühling. Wir befinden uns im Jahr 1966 in einer Großstadt im Norden Chinas.
Denis Scheck, Literaturredakteur beim Deutschlandfunk, bespricht einmal monatlich die "Spiegel“-Bestsellerliste, abwechselnd Belletristik und Sachbuch – parallel zu seiner ARD-Sendung "Druckfrisch“.
Katja Behrens schmückt eine historische Reise von Moses Mendelssohns aus.
Caroline B. Cooney erzählt in einem aufregenden Thriller von Bioterrorismus und Seuchen
Grit Poppe erinnert in ihrem Roman "Weggesperrt“ an den Schrecken der DDR-Jugendwerkhöfe.

Navid Kermani liest im Berliner Gropius-Bau – und will die Idee des altruistischen Opfers retten.
Eine feine Sache und längst überfällig: Steffen Richter über ein Lexikon zur DDR–Literatur mit kompakt-kompetenten Essays zum Thema.
Wie der Dichter Nicolas Born sich selbst aus den Fesseln der Ideologie befreite und die Poesie vor der Politik rettete - oder doch eher vor dem Zeitgeist? Eine Podiumsdiskussion.über die Achtundsechziger und ihre Wirkung.
Still ist es geworden um Tschetschenien. Nachrichten aus anderen Zonen des Terrors und der Kriege haben die Augen der Öffentlichkeit längst in die Richtung Afghanistans oder Pakistans gelenkt.: Jonathan Littell hat sich auf Spurensuche nach Terror und Despotismus begeben
30 Jahre Grüne: Der frühere Parteichef Ludger Volmer sieht keinen Anlass zum Feiern. Es hat aber immer etwas Trauriges, wenn ehemals prominente Politiker einer Partei nach ihrem Ausscheiden mit alten Mitstreitern abrechnen, wie sie das als aktive Politiker nie getan haben.
Der österreichische Dichter Raoul Schrott hatte bei den Berliner Lektionen im Renaissance-Theater ein diffiziles Thema mitgebracht: Einen Streifzug durch die Politik des Heiligen.