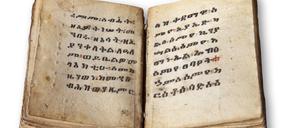
Die Berliner Ägyptologin Eliese-Sophia Lincke forscht an koptischen Handschriften. Das Problem: Ohne digitalisierte Texte ist die Arbeit mühsam. Um das zu erleichtern, trainiert sie jetzt selbst eine Software.
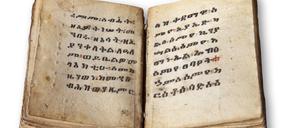
Die Berliner Ägyptologin Eliese-Sophia Lincke forscht an koptischen Handschriften. Das Problem: Ohne digitalisierte Texte ist die Arbeit mühsam. Um das zu erleichtern, trainiert sie jetzt selbst eine Software.

Fast ein Viertel weniger Studienanfänger: Geisteswissenschaften liegen nicht im Trend. Das passt zu einer Politik, die Rüstung mehr pusht als Bildung. Dabei braucht es gerade in diesen Zeiten Dichter und Denker.

Die USA verlieren ihre Rolle als freie Wissenschaftsnation. Doch statt davon zu profitieren, sollte Deutschland helfen, den Schaden zu begrenzen – aus Vernunft und Verantwortung.

Gefeuerte Wissenschaftler, Forschungsthemen auf dem Index, Unis verlieren ihre Finanzierung: Was in den USA geschieht, macht Einmischung nötig, sagt der Vorstandsvorsitzende der Berliner Einstein-Stiftung.

Versuche, über heikle Dinge zu sprechen, endeten eher früher als später bei der Oktoberrevolution

Kann man über Geschmack wirklich streiten? Ein Gespräch mit Johannes Franzen über peinliche Lieblingsfilme, den Paradigmenwechsel durch die Digitalisierung und das schwindende Bildungsbürgertum.

Seine Mutter war Jüdin, doch Fritz Heegner überlebte Nazizeit und Krieg mitten in Berlin-Charlottenburg. Nun erzählt der 95-jährige Regisseur von seiner Jugend – und zeigt seinen neuen Film.

Der Vorschlag von Senatorin Ina Czyborra, die Geisteswissenschaften an der TU Berlin abzuschaffen, ist verantwortungslos. Er widerspricht der Lehre aus der NS-Zeit, technische Fächer nicht unreflektiert zu betreiben.

Steven Pinker lehrt in Harvard Psychologie und hat mehrere Bestseller geschrieben. Sein Blick auf das aktuelle Weltgeschehen ist klar: Die Menschheit dreht trotz allem nicht komplett durch.

Für die Geburtstagstorten war sie schon länger zuständig. Heute teilt die 34-Jährige fulminante Patisserie-Prachtwerke auf ihrem Erfolgsblog „La Crema Patisserie“.

Über drei Jahrzehnte trug der Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin zur Aufarbeitung der DDR- und Kommunismusgeschichte bei.

Die Berliner Wissenschaft bekommt bis 2027 fast eine Milliarde Euro weniger, es trifft vor allem die Hochschulen. Ina Czyborra (SPD) erklärt, wo sie das Studienangebot verkleinern will und wer geschont wird.

Nach einem abgesagten Vortrag der UN-Sonderberichterstatterin Albanese haben etwa 40 Personen einen Hörsaal beansprucht, um die Ersatzveranstaltung zu streamen. Die Linke bezeichnet die Absage als „zutiefst verstörend“.

Wer auf hohem Level forscht, hat unsichere Karrierechancen. Die Wirtschaft lockt mit Sicherheit und gutem Lohn. Im Wahlkampf ist das kein Thema. Doch die neue Regierung wird an ihm nicht vorbeikommen.

Spätestens seit die deutsche Fußballnationalelf ihre pinken Trikots vorstellte, war klar: Keine Farbe polarisiert so sehr. Aber warum eigentlich?

Ihr Podcast „Mord auf Ex“ ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Zusammen haben Leonie Bartsch und Linn Schütze auch ihre eigene Produktionsfirma gegründet – und gehen gemeinsam auf Tour.

Die Plätze an Gymnasien sind knapp – das sorgt für Druck im Ü7-Verfahren. Was Eltern jetzt wissen müssen, welche Zugangsvoraussetzungen an den einzelnen Schulen gelten und welche am beliebtesten sind.
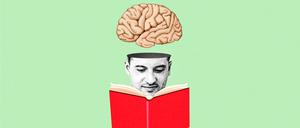
Einen Abschluss in Literaturwissenschaft, seitdem aber kaum gelesen: Das Verhältnis unseres Autors zum Buch ist typisch für die Deutschen. Er fragt sich zunehmend, ob das ein Problem ist.

Die feministische Schweizer Dramatikerin Katja Brunner nimmt sich William Shakespeares Stück „Der Widerspenstigen Zähmung“ vor und lässt daran kein patriarachales Haar.

Er porträtierte Olaf Scholz, reiste mit Annalena Baerbock und freute sich, dass Christian Lindner „viel anbietet“. Sah Dominik Butzmann das Ende der Ampel kommen?

Die Kürzungen des Senats in der Wissenschaft treffen nun auch die Romanistik: An der Humboldt-Uni soll die Italianistik komplett aufgegeben werden.

Der Historiker Ewald Frie und der Soziologe Boris Nieswand leuchten am Beispiel des Tübinger Uni-Projekts „Bedrohte Ordnungen“ in die Absurditäten finanziell gut ausgestatteter Promotionsmaschinen hinein.

Fortwirkender Zauber: Thomas Manns berühmtester Roman ist das Spiegelkabinett eines dauerkriselnden Jahrhunderts, in dem auch die Gegenwart noch etwas von sich erkennen kann.

Weiße Männer sind CEOs, schwarze Frauen Sozialarbeiterinnen? Künstliche Intelligenz-Systeme können Stereotype verstärken. Daher braucht es Diversity-Kompetenz bei Entwicklern.

Kulturhistoriker Wolfgang Hardtwig setzt seine Erinnerungen mit einem Buch über die politischen und akademischen Verwerfungen der vergangenen 50 Jahre fort. Es ist plastisch wie reflektiert.

Sie zähmen Algorithmen, lassen Maschinen lernen und bauen die Basis für eine Energiewende. Von den Theoriekniffen dieser Forschenden kann auch die Wirtschaft der Zukunft profitieren. Folge sieben unserer Serie.

Sie entschlüsseln historische Zeugnisse und die Zeichen der Gegenwart. Von ihren Reisen in die Zeit- und Erdgeschichte bringen diese Forschenden wichtige Erkenntnisse mit – und werfen neue Fragen auf. Teil acht der Serie.

Am 5. November wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt – oder eine Präsidentin. Das sind die fünf interessantesten Adressen für die Wahlnacht.

Bitte kein Programm, aber die Bereitschaft, den eigenen Standpunkt infrage zu stellen: Der Schweizer Komparatist lädt ein zu einem dialektischen Zirkeltraining.
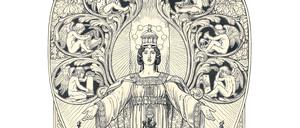
Die Technikhistorikerin Heike Weber wirft einen Blick auf die Historie der Ingenieurwissenschaften an der TU Berlin.

Frank Fischer ist Professor für Digital Humanities an der Freien Universität. Ein Porträt mit Hackathons, Team-Arbeit und einer ganz besonderen KI.
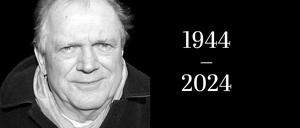
Er war faul und prügelte sich gern - klar, dass er zu den Verlierern gehören würde. Ganz so ist es nicht gekommen

Als Marxist ließ er es sich nicht nehmen, Kultur und Ökonomie als untrennbar zu verstehen. Die Phänomene, die er dabei untersuchte, reichten von der Architektur bis zur Literatur – auch in in ihren populäreren Spielarten.

Der Aktionskünstler im Gespräch über den Reiz des Faschismus, Parallelen von heute zur Weimarer Republik und das Dauergrinsen von Olaf Scholz.

Studierende setzen sich dafür ein, dass ein Dozent an der Uni bleibt. Jetzt beklagt die Gruppe Einschüchterungsversuche gegen sie und bewusste Irreführung seitens des Uni-Präsidenten.

Der Verband der Kunsthistoriker vergibt seinen Negativpreis für den Abriss eines denkmalgeschützten Gebäudes am BER.

Auch wenn Literatur oft Schmerzgrenzen überschreitet: Die Kunstfreiheit bräuchte es laut dem Juristen Christoph Möllers nicht als eigenes Grundrecht. Die These knüpfte er an einen vergessenen Fall Berliner Uni-Geschichte.

Seit dem Brexit sind die britischen Unis in tiefer Krise, auch der Austausch mit Deutschland leidet. Doch Berlin und Oxford sind seitdem näher gerückt, um ihre Forschung zu globalen Problemen zu stärken.

Programmierer haben ausgedient. Ingenieure braucht kein Mensch mehr. Und KI ist besser als jeder Anwalt. Warum sich ein Studium dennoch lohnt.

Dieses Buch ist kein Ratgeber. Vielmehr bringt es zitierfreudig Traditionen zum Sprechen, die schon immer wussten, dass das Leben nur mit Blick auf den Tod gelingen kann.
öffnet in neuem Tab oder Fenster